Sandra Schlenker
Glückliche Mitarbeiter: Was der Weltglücksreport uns für die Unternehmensführung lehrt.
Zufriedene und glückliche Mitarbeiter sind ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsfaktor. Aber was brauchen wir, um glücklich zu sein? Der Weltglücksreport gibt Antworten – und die sind auch für die Unternehmensführung sehr relevant!

Glückliche Mitarbeiter: Ein echter Wettbewerbsvorteil.
Glückliche Mitarbeiter sind nicht nur zufrieden, sie sind auch ein echter Wettbewerbsvorteil.
Glückliche Mitarbeiter
- sind loyaler,
- haben eine höhere emotionale Bindung ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber gegenüber
- und daher ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie kündigen (offen oder innerlich),
- bringen bessere Leistungen und sind engagierter
- treten besser nach außen und gegenüber dem Kunden auf
- sind gut für die Reputation des Unternehmens und erhöhen die Arbeitgeberattraktivität
- und sie sind gut für die Stimmung im Unternehmen.
Doch was macht uns bei der Arbeit glücklich? Was bedeutet „Glück„, und durch welche Faktoren wird es beeinflusst? Um herauszufinden, welche Faktoren wichtig sind und was uns bei der Arbeit glücklich macht und wie man diese Faktoren gezielt stärken könnte, haben wir die umfassendste Studie zu diesem Thema analysiert: Den Weltglücksreport.
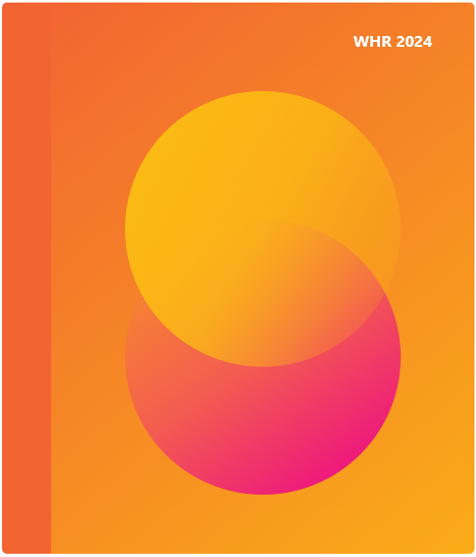
Der Weltglücksreport („World Happiness Report“) ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht. Der Bericht enthält jeweils die Rangliste zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der Welt und zugehörige Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Der Report umfasst den Zustand des weltweit empfundenen Glücks und der Lebenszufriedenheit, Ursachen für Glück und Unglück sowie politische Folgerungen, und dokumentiert diesen mit Fallstudien. In erster Linie ist die Absicht des Weltglücksreports, der aufgrund einer Initiative der Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen wurde, Politik und Gesellschaft Impulse zu geben, um gesellschaftliche Entwicklungen voranzutreiben und um Bildungsinitiativen, Zivilgesellschaft, bürgerliches Engagement und Meinungsfreiheit zu fördern.
Unternehmenspolitik und Mitarbeiterführung waren nicht im Blickfeld der Initiatoren des Weltglücksreports. Und doch sind die Erkenntnisse aus dem Weltglücksreport auch hierfür direkt relevant und nutzbar, wie wir gleich sehen werden.
Was bedeutet Glück? Die 5 Dimensionen des Glücks.
Was bedeutet „Glück“? Glück hat natürlich viele Facetten, und ist natürlich letzten Endes auch eine individuelle Sache. Wir alle werden „Glück“ und „glücklich sein“ mit unterschiedlichen Dingen assoziieren.
Auch Kollegen aus dem DNLA-Beraternetzwerk, wie Martin Lischka, haben sich schon auf die Suche nach der Weltglücksformel gemacht, um uns alle einzuladen, über das Glück, über unser Leben, unsere Arbeit und das, was wir tun, nachzudenken.

Bei allen individuellen Unterschieden gibt es doch einige klar identifizierbare Rahmenbedingungen, die für das Glück, bzw. für die Möglichkeit, ein glückliches Leben führen zu können, wichtig sind. Wir stellen sie hier kurz vor und betrachten dabei auch, was diese 5 Dimensionen bezogen auf die Arbeitswelt bedeuten.

1. Einkommen / materielle Sicherheit
Wichtig, um ein glückliches Leben führen zu können und um die eigenen Potenziale zu entfalten sind ein ausreichendes Einkommen und materielle Sicherheit.
Für die Mitarbeiterführung und für glückliche Mitarbeiter ist es also wichtig, diesen einen fairen, ausreichenden Lohn zu bieten und darüber hinaus auch langfristig eine gesicherte Zukunftsperspektive im Unternehmen.

2. Großzügigkeit / andere unterstützen, für andere etwas Sinnvolles tun.
Doch nicht nur materielle Sicherheit ist wichtig für unser Glück. Auch der Sinn bei der Arbeit ist von erheblicher Bedeutung.
Die Identifikation mit dem Arbeitgeber und mit den Arbeitsinhalten und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, sind also elementar wichtig, damit wir uns glücklich bei der Arbeit fühlen.

3. Unterstützung / Gemeinschaft (keine Isolation) / soziale Zugehörigkeit
Genauso wichtig wie das Gefühl, für andere etwas Sinnvolles zu tun, ist das Gefühl unterstützt zu werden, dazuzugehören und nicht auf sich alleine gestellt zu sein.
Eine gute Zusammenarbeit im Team und Rückhalt durch die Führungskräfte sind also wichtig für das Glück am Arbeitsplatz. Das gilt immer, besonders aber in schwierigen Zeiten, die mit Stress und besonderen beruflichen und/ oder privaten Belastungen verbunden sind.

4. Entscheidungsfreiheit / Wahlfreiheit; Abwesenheit von Diskriminierung und die Möglichkeit, sich zu entfalten.
Wir alle haben Ideen, möchten Einfluss nehmen und mitgestalten. Und wir möchten selbst entscheiden können, welchen Weg wir gehen – das gilt privat genauso wie im beruflichen Bereich.
Um glücklich bei der Arbeit zu sein, ist es daher wichtig, dass die Mitarbeitenden inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass ihnen auch Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten offen stehen. Fehlende Perspektive, Diskriminierung und eine „gläserne Decke“ hingegen zerstören das Glück am Arbeitsplatz.

5. Abwesenheit von Korruption / Fairness, Zuverlässigkeit und Loyalität.
Auch diese Dimension ist im Unternehmen genauso wichtig wie allgemein in der Gesellschaft. Wenn Menschen merken, dass sie unfair behandelt werden, dann sind Frustration und Verunsicherung die Folge.
Bei der Beförderung, bei Beurteilungssystemen, beim Feedback – das Thema „Fairness“ spielt eine große Rolle für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmensalltag. Nur wenn es fair im Unternehmen zugeht, können die Mitarbeitenden dort auch glücklich sein.

Die 5 Dimensionen des Glücks am Arbeitsplatz: So bekommt man glückliche Mitarbeiter.
So weit, so einleuchtend. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus zahllosen Umfragen und Studien, dass es mit dem Glück und der Zufriedenheit am Arbeitsplatz oft nicht weit her ist. Was also kann man machen, damit es im Unternehmen mehr glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt und damit all die eingangs erwähnten positiven Effekte auch eintreten? Wir geben hier Tipps, die für glückliche Mitarbeiter – und für den Unternehmenserfolg – sorgen.

Nun, wenn man die hier bereits veröffentlichten Artikel durchgeht, dann wird man feststellen, dass das Prinzip „Der Mensch im Mittelpunkt“ gut zusammenfasst, wie eine Unternehmensführung aussehen muss, die für glückliche und zufriedene (und damit auch engagierte und erfolgreiche) Mitarbeitende sorgt und die vielerorts vorherrschende Unzufriedenheit und Motivationsmisere bekämpfen kann. Da wir die verschiedenen Themen in den einzelnen Fachbeiträgen bereits ausführlich erläutert haben hier an dieser Stelle nur noch einmal eine Aufzählung mit den entsprechenden Links im Überblick:
Von herausragender Bedeutung für glückliche Mitarbeiter: Das Verhalten der Führungskräfte, Empathische Führung und Loyal Leadership (Loyale Führung), gezielte Führungskräfteentwicklung, um das zu erreichen, eine gesunde Unternehmenskultur und das Bekämpfen der „gläsernen Decke“, beispielsweise für weibliche Führungskräfte sind wichtige Punkte.
Ebenso wichtig: Unterstützung in Krisenzeiten, Vorbeugung und Bekämpfung von Stressbelastung am Arbeitsplatz, eine konstruktive Konfliktkultur und Maßnahmen, die eine gute Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern, die gute Begleitung von Auszubildenden von Anfang an durch die Ausbilder*innen und durch geeignete Programme, die individuelle Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um ihr Potenzial zu erkennen und gezielt zu fördern und das Berücksichtigen verschiedener Bedürfnisse, zum Beispiel bei älteren Mitarbeitenden, bei Hochbegabten oder im Bezug auf Neurodivergenz.

Zuletzt seien hier noch die Professionelle Personalauswahl unter besonderer Berücksichtigung von tatsächlichen Fähigkeiten („Skills based recruiting“) und von Soft Skills (statt des Einsatzes fragwürdiger und unausgereifter Methoden und einer immer stärkeren Automatisierung und Entpersonalisierung des Rekrutierungs- und Personalauswahlprozesses) für eine enge Mitarbeiterbindung von Anfang an und für eine gute Beziehungsebene sogar zu den Bewerberinnen und Bewerbern, die im Moment nicht in Frage kommen genannt, die gleichzeitig das erste Element einer gute Unternehmenskultur ist, und die wiederum durch Dinge, die die Arbeitgeberattraktivität stärken und die ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen, ergänzt wird.
Sicherheit und Zufriedenheit, flexible, individuelle Regelungen (zum Beispiel bei Arbeitszeit und Arbeitsort), Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Gleichberechtigung, Werte und kulturelle Fragen – das alles sind auch Dinge, die bei Befragungen von Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen und Ländern als wichtig und vorrangig genannt werden, wie man hier nachlesen kann – und das deckt sich also bereits stark mit den hier genannten Aspekten.
Erkennen, ob man glückliche oder unglückliche Mitarbeiter hat: Professionelle Potenzialanalysen als wertvolles Hilfsmittel und als Katalysator für gute Gespräche.
Wir haben schon anhand dieser Aufzählung gesehen, dass es hier viele Aspekte und viele Punkte gibt, an denen man als Verantwortliche*r im Unternehmen Dinge richtig, oder eben leider auch vieles falsch machen kann. Das Problem in den Unternehmen dürfte dabei auch weniger das fehlende Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Themen sein, sondern vielmehr die Schwierigkeit, zu wissen, wo genau im Einzelfall angesetzt werden muss und welche Dinge bereits gut laufen und bei welchen sich – vielleicht von außen unbemerkt – Probleme und Frust aufbauen.
Abhilfe schaffen hier geeignete Analyseverfahren. Sie helfen, herauszufinden, wo Überforderung oder Unzufriedenheit vorliegen, wo Ideen und Eigeninitiative blockiert sind, wo Ängste und Unsicherheit das vorhandene Potenzial blockieren und an welchen Stellen Unterstützung, insbesondere durch die Führungskräfte, nötig ist.
Wir geben im Folgenden konkrete Beispiele für die oben genannten 5 Dmensionen des Glücks, an welchen Stellen in den Potenzialanalysen DNLA – Discovering Natural Latent Abilities ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz und MM – Management und Führung Anhaltspunkte geben, wo das Ziel, glückliche und erfolgreiche Mitarbeiter zu haben, gefährdet ist und wo im Unternehmen man Dinge besser machen kann.

1. Einkommen / materielle Sicherheit
- Einkommen und materielle Aspekte und noch konkreter Themen wie: „Bin ich mir bewusst, was meine eigene Arbeit und meine Leistung wert sind?“ sowie das Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ beleuchtet der Faktor „Statusmotivation“.
- Das Thema der Akzeptanz und die Sicherheit, frei von Angst vor negativen Konsequenzen und, zum Beispiel, Arbeitsplatzverlust, agieren zu können, betrachtet der Faktor „Selbstsicherheit“.

2. Großzügigkeit / andere unterstützen, für andere etwas Sinnvolles tun.
- Sinn bei der Arbeit und die Wertschätzung, die man von anderen erhält, das alles macht sich positiv im Faktor „Motivation“ bemerkbar.
- Bezogen auf das Thema „Führung“ sind es Faktoren wie „Identifikation“ und „Personenorientierung“, die hier eine Rolle spielen, aber auch die „Teamarbeit“.

3. Unterstützung / Gemeinschaft (keine Isolation) / soziale Zugehörigkeit
- Der Faktor „Arbeitszufriedenheit“ zeigt, wie zufrieden man mit den konkreten Arbeitsumständen und den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein gutes kollegiales Umfeld.
- „Kontaktfähigkeit“ hilft, Distanz abzubauen und ein gutes, auf Vertrauen aufbauendes Arbeitsverhältnis zu pflegen.
- Einfühlungsvermögen ist notwendig, um sich in Andere (Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen) hineinzuversetzen, und auf ihre Situation eingehen zu können. Eine wichtige Voraussetzung für Mitarbeiterorientierte Führung.
- „Verantwortung für Mitarbeiter“ ist ebenfalls ein Aspekt der Führung, der hiermit ganz eng zu tun hat.

4. Entscheidungsfreiheit / Wahlfreiheit; Abwesenheit von Diskriminierung und die Möglichkeit, sich zu entfalten.
- „Gender-“ und „Diversitykompetenz“ sind Faktoren, die wir extra entwickelt und in die Analysen aufgenommen haben, damit ein Anhaltspunkt vorliegt, wie objektiv und Vorurteilsfrei Führungskräfte Mitarbeitende behandeln und beurteilen.
- Die „Einbeziehung“ der Teammitglieder bei Veränderungen im Unternehmen und bei anstehenden Entscheidungen und das Maß, in dem sie ihre eigene „Initiative“ einbringen und ausleben können, sind ebenfalls wichtige Elemente. Sie helfen, dass die Mitarbeitenden mit gestalten können – und davon profitieren sie selbst wie auch die Unternehmen.
- Dasselbe gilt natürlich für alles, was im Bereich „Mitarbeiter-Entwicklung“ stattfindet.

5. Abwesenheit von Korruption / Fairness, Zuverlässigkeit und Loyalität.
- Diese Aspekte werden insbesondere beim Faktor „Machtverhalten“ berücksichtigt.
- Auch bei Faktoren wie „Leistungsforderung“, „Delegation“ und „Autorität“ können sie eine Rolle spielen.
Die DNLA-Analysen messen also viele Faktoren, die relevante Aspekte des Führungsverhaltens abbilden. Außerdem zeigt sich an vielen Stellen in den Analysen – und die hier aufgelisteten Beispiele sind längst nicht alle, die man hätte nennen können – wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht und wo Handlungsbedarf besteht.
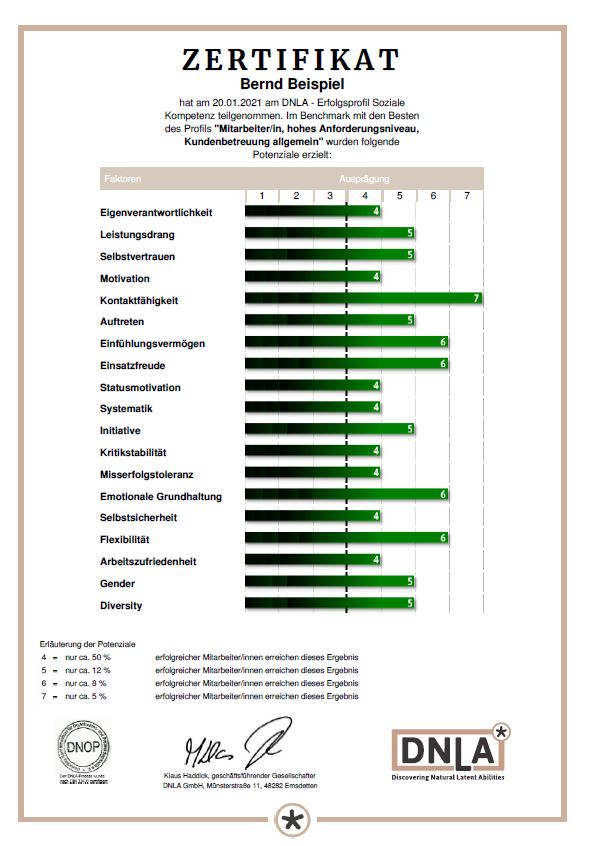
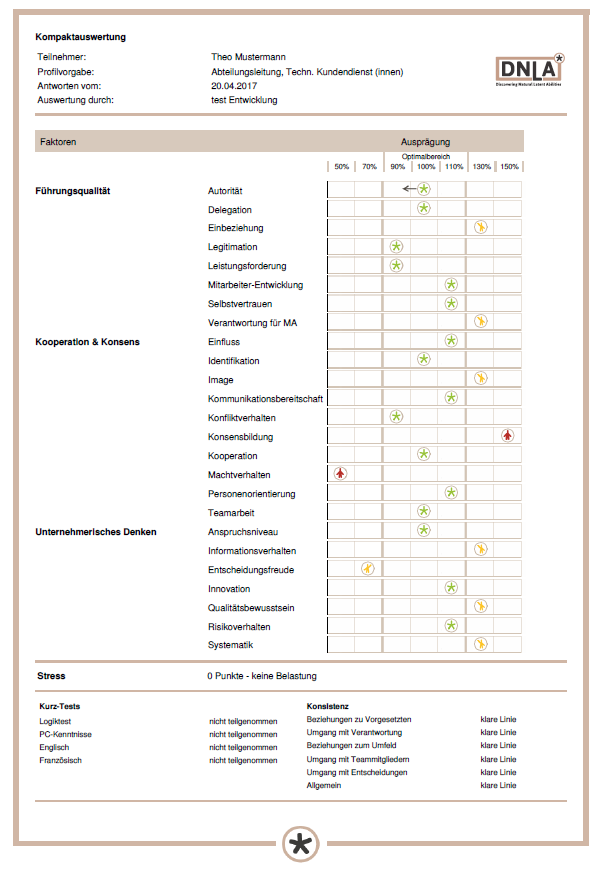
Eine gezielte Anwendung der Analysen, kombiniert mit professioneller Begleitung und Beratung, führt dazu, die Mitarbeiterzufriedenheit – oder anders gesagt: das „Glück“ am Arbeitsplatz signifikant zu erhöhen, wie auch zahlreiche Teilnehmerfeedbacks zeigen. Eine Teilnehmerin hat das so formuliert: „Der Wert liegt in der dauerhaft positiven Veränderung und Verbesserung der Lebensqualität. Hinsichtlich beruflicher Ebene oder auch privater.“

„Stars@work“: Ausbildung neu denken, wert-voll ausbilden und Wachstum erreichen.
Unser DNLA-Netzwerkpartner Thorsten Ebeling und seine Partnerin Sandra Schlenker haben die Initiative „Stars@work“ ins Leben gerufen. Wir haben mit Thorsten über ihre Ideen und Ziele gesprochen.
Interview mit Thorsten Ebeling über Stars@work:
Thorsten, wie ist die Idee zu „Stars@work“ entstanden?
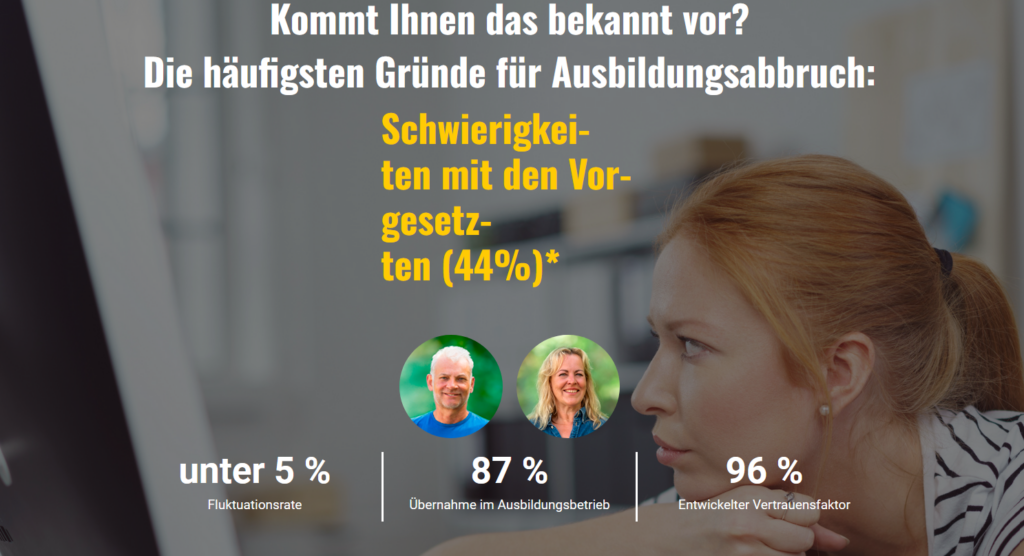
Thorsten:
- Vor 6 Jahren hat mich mein Kunde, die Lieblingsbar in Hannover, damit beauftragt für ihre Auszubildenden Persönlichkeitsentfaltung für eigendynamische Gastfreundschaft zu trainieren.
Das habe ich die ersten 2 Jahre gemeinsam mit den Inhabern entwickelt und auf Basis Blended Learning in Kombination mit strukturierter Begleitung durch Mentoren (Ausbildern). - Mit den ersten 8 Teilnehmenden haben wir tolle Erfolge und Stories erzielt, die allerdings nicht oder nur teilweise messbar die gewünschten Ergebnisse brachten.
- 2020 habe ich mit Sandra beruflich eine Weiterbildung auf Mallorca angeboten. Weil die Pandemie begann, haben wir letztlich 3 Wochen fast allein dort verbracht und die Zeit genutzt, das Programm zu verfeinern.
- Die Kernideen sieht man hier im Bild:
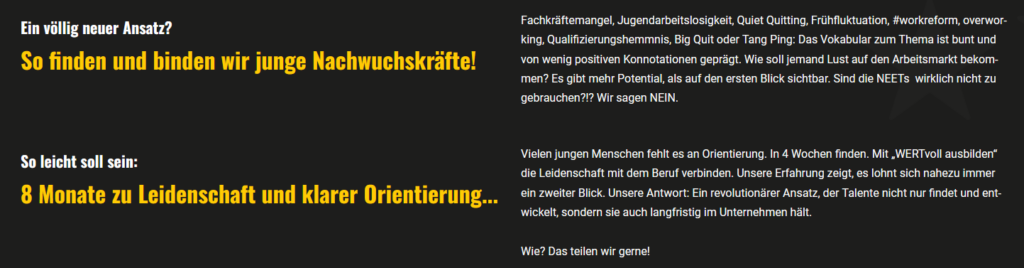
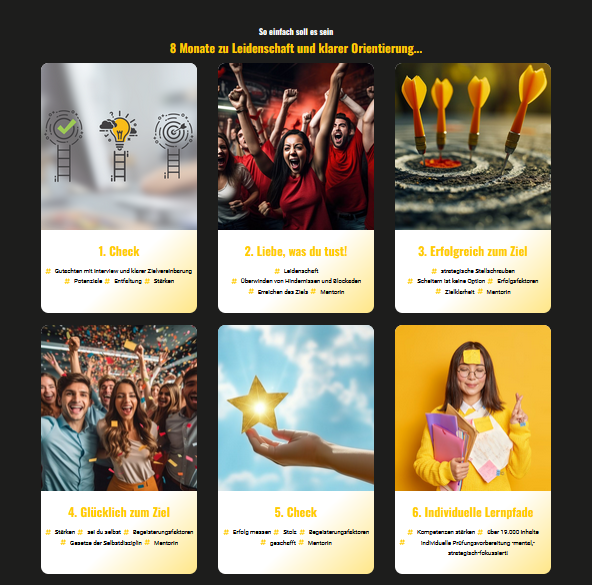
Der Weg bei Stars@work (Grafik von der Stars@work-Webseite www.wertvoll-ausbilden.de).
- Mit einigen kleineren Kunden und Einzelpersonen haben wir DNLA als Evaluations- und Kern-Entwicklungs-Tool eingeführt. Den begleitenden Online-Kurs haben wir so konzipiert, dass die Inhalte und Themen für jeden Menschen in jeder Situation anwendbar ist (bis jetzt sind nur unsere persönlichen Grenzen hinderlich).
- Seit 2 Monaten sind wir in der letzten Testphase. Unsere Eigentests laufen hervorragend. Die ersten Pilotprojekte sind gestartet und die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen.
- Unser Produkt „WERTvoll ausbilden“ hat nun einen Reifegrad zur Skalierung.
Danke Thorsten, das klingt super spannend, und bringt mich direkt zu Punkt 2: Was sind eure Ziele für dieses Jahr?
Thorsten:
- Unsere Ziele in 2024? Nun, mit „WERTvoll ausbilden“ wollen wir bis zum 1.9. 500 Teilnehmende akquirieren. Die dafür nötigen DNLA-Gutachten und Feedbacks, die Betreuung, das bekommen wir von unseren Ressourcen abgebildet.
- Während der Fertigstellung von „WERTvoll ausbilden“ ist zudem noch ein „Nebenprodukt“ entstanden. „start@work“, unser Berufsorientierungskurs.
- Hier können wir das Potential noch nicht ganz abschätzen. Die ersten beiden Kandidaten, die gerade im Kurs aktiv sind, machen unterschiedliche Fortschritte. Das liegt daran, dass wir gerade einen Kandidaten nur Online mit telefonischer Begleitung betreuen und den anderen real mit tiefergehenden Methoden versorgen.
- Die Ergebnisse in 3 Monaten werden mehr Erkenntnisse bringen. Wir sind davon überzeugt, dass das Produkt noch viel mehr Potential hat. Dazu sind wir in vorbereitenden Gesprächen mit der Wirtschaftsförderung Hannover und der Regierung der Region Hannover, um ein erstes gemeinsames Projekt dazu zu starten.
Das klingt nach einer Menge Arbeit – aber auch nach einer Menge Spaß. 🙂 Welche konkreten Schritte stehen nun an, woran arbeitet ihr derzeit bei Stars@work?
Thorsten:
Ja, natürlich ist viel zu tun, um so etwas ans laufen zu bringen. Unsere Prioritäten dabei sind derzeit:
1. Die Akquise unserer ersten 500 Teilnehmer*innen.
2. Die Fertigstellung der Landingpage (www.wertvoll-ausbilden.de) und der Homepage (www.starsatwork.de)
3. Die Vollendung der „bürokratischen“ Unternehmensgründung in Spanien
4. Bis Ende April wollen wir unsere erlebten Highlights verfilmen und in Stories verpacken, die wir gemeinsam für unsere Aussenwirkung nutzen können. Wir planen 2 x im Jahr eine Produktion, die dann Content für 12 Monate oder mehr bietet.
Gibt es schon konkrete Erlebnisse, die ihr mit uns teilen wollt?
Wir haben zahlreiche Erlebnisse, die wir mit anderen teilen wollen. Hierfür haben wir schon vieles vorbereitet. Das wird im Moment noch professionell aufbereitet, um die verschiedenen Zielgruppen gut „abzuholen“. Folgt uns in den Sozialen (Business-)Netzwerken und seid gespannt, auf die Geschichten, die wir mit euch teilen werden!
Da bahnt sich etwas Großes an. Das ist nicht alleine zu schaffen. Welche Unterstützer und Partner habt ihr bereits und welche Art von Verstärkung könnt ihr noch gebrauchen?
Thorsten:
- Zuallererst sehen wir natürlich euch, also DNLA, als strategischen Partner, weil DNLA die optimalsten Einstiegsbedingungen bietet für unsere Arbeit mit den Jugendlichen.
- Ebenfalls strategischer Partner bei Stars@work ist Blinkit als Lernplattform-Anbieter.
- Und als Mitstreiter sehen wir derzeit auch unsere Kunden, die ja das Programm mitgestalten sollen.
Darüber hinaus, da unsere Ressourcen begrenzt sind, suchen wir „externe Mentoren“, Coaches, Trainer, Berater, die unsere Produkte in Lizenz nutzen wollen. Zwei davon befinden sich schon bei uns in der Mentoren-Ausbildung.
Wenn nun Interessenten – Unternehmen oder junge Leute / Auszubildende, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem DNLA-Partnernetzwerk euch kontaktieren wollen, wie seid ihr am besten zu erreichen?
Thorsten:
- Jeder Interessent hat die Möglichkeit uns über Telefon, WhatsApp oder E-Mail zu kontaktieren. Über unsere Landingpage kann ein Informationsgespräch gebucht, Info-Material angefordert oder direkt der Kurs betreten werden.
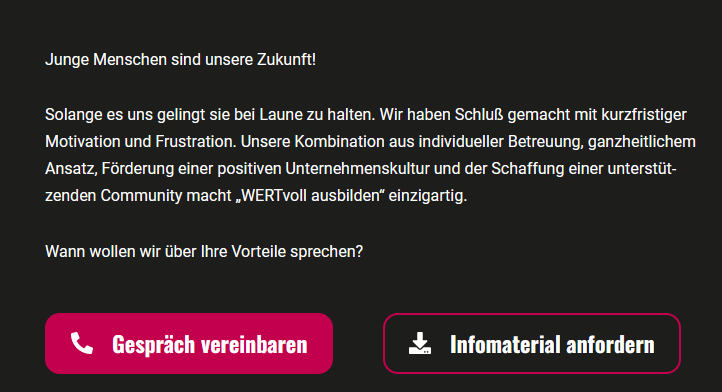
Wer mit Thorsten Ebeling in Kontakt treten und mehr über Stars@work erfahren möchte, findet hier weitere Informationen:
Thorsten Ebeling
thorsten@starsatwork.de
Büro: +49 511 353 969 888
Ein Partnerportrait und weitere Informationen zu Stars@Work findet ihr hier: https://www.dnla.de/dnla_partner/thorsten-ebeling-trainer-coach-berater/
Über Thorsten Ebeling und Sandra Schlenker, die Initiatoren von Stars@work:

Thorsten Ebeling
Mensch & Mentor
Thorsten Ebeling ist erst Installateur, wird dann Unternehmer und Investor, Buchautor, Trainer, Mentor, Berater und Coach. Er ist Prüfungsverantwortlicher, Strategie- und Kulturentwickler, Weiterbildner und leidenschaftlicher Lerndidaktiker und vor allem eins: Thorsten Ebeling ist Mensch. Sein Herz schlägt für Menschen und deren Entwicklung. Für seine Kinder, deren Freunde, die ihm anvertrauten Auszubildenden, die unter seinen nervenden Fragen auch schon mal den Kopf schütteln. Und dadurch den nötigen Stupser bekommen, um über sich hinauszuwachsen. Mehr als zehn Jahre beim Kinderschutzbund mit Jugendlichen aktiv und selbst Inhaber eines Ausbildungsbetriebs, kennt er nicht nur die hellen, sondern auch die Schattenseiten. Und daher weiß er ziemlich genau, wie man junge Menschen zum Strahlen bringt.

Was ist schon „normal“? Neurodivergenz und Neurodiversität als Herausforderung und als Chance im Unternehmen
Lange Zeit war es so, dass Menschen, die nicht in eine bestimmte „Schublade“ passen und die zu sehr von der Norm – die sich meist dadurch definiert, was für die Mehrheit der Menschen in einer Gesellschaft „normal“ ist bzw. scheint – abweichen, bestimmte Wege und Möglichkeiten verschlossen blieben. Das galt auch und gerade im beruflichen Bereich, und in vielen Unternehmen ist das leider auch heute noch so. Aber langsam setzt ein Umdenken ein: Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema „Neurodiversität“.
In diesem Beitrag beleuchten wir, was „Neurodivergenz“ und „Neurodiversität“ sind und warum diese Themen für unsere Arbeitswelt immer wichtiger werden. Außerdem geben wir Tipps für die Praxis und zeigen, wie die Arbeit für alle besser organisiert werden kann.
Was versteht man unter „Neurodivergenz“ und „Neurodiversität“?
Neurodivergenz: Was bedeutet neurodivergent? Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Norm liegend (also als «normal» oder «neurotypisch») definiert, dann wird dieser Mensch als neurodivergent bezeichnet.
Diagnosen wie Autismus (bzw. eine Ausprägung auf dem sehr breiten Spektrum von Autismus) und AD(H)S, aber auch Angststörungen und die neurologischen Auswirkungen von Traumata sind defizitär ausgelegt. Sie beschreiben in der Regel eine Abweichung von der Norm und machen diese Abweichung zu etwas schlechtem, krankhaftem. Außerdem werden sie in der Gesellschaft meist so gebraucht, dass Menschen auf einen einzigen Aspekt reduziert werden – „der da ist ein Autist“. Andere Eigenschaften und Fähigkeiten dieser Personen werden ausgeblendet, andere „Rollen“ scheinen für diese Personen nicht mehr vorgesehen.

„Neurodiversität“ dagegen begreift Autismus, AD(H)S und Co nicht als psychische Störung, sondern als eine Variante des Seins. Neurodiverse Menschen sind demnach nicht schlechter, nicht unnormal, nicht kaputt oder krank. Sie sind nur anders.
Neurodiversität ist ein Fachbegriff aus einem Konzept, in dem neurobiologische Unterschiede als eine menschliche Disposition unter anderen angesehen und respektiert werden; atypische neurologische Entwicklungen werden als natürliche menschliche Unterschiede eingeordnet. Nachdem das Konzept Menschen jedweden neurologischen Status umfasst, sind alle Menschen als neurodivers zu betrachten. Der Begriff Neuro-Minderheit („neurominority“) verweist auf Menschen, die als Minderheit nicht neurotypisch sind.
Zum Konzept der Neurodiversität werden unter anderem Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Dyskalkulie, Legasthenie, Dyspraxie, Synästhesie, die bipolare Störung und Hochbegabung gezählt. Diese verschiedenen Neuro-Typen können also, genauso wie andere Merkmale einer Person, als natürliche Formen der menschlichen Diversität angesehen werden und nicht als pathologische, „krankhafte“ Erscheinungsformen.
Das bedeutet konkret: Neurodiversität steht für neurologische Vielfalt. Jeder Mensch, jedes Gehirn ist anders. Neurodiversität meint, dass es nicht den einen neurobiologischen Bauplan gibt, sondern viele verschiedene. Autismus, AD(H)S und andere Entwicklungsstörungen oder psychische Krankheiten sind nichts weiter als neurologische Varianten. Es sind Gehirne, die anders verdrahtet sind, anders geschaltet. Und die sich dementsprechend anders entwickeln, anders wahrnehmen und kommunizieren.
Neurodivergenz und Neurodiversität im Unternehmen:
Nach dieser Begriffsklärung und inhaltlichen Einordnung zum aktuellen Stand der Debatte wollen wir nun darüber sprechen, wie sich Neurodivergenz und Neurodiversität zum Alltag und den Anforderungen in den Unternehmen verhalten.
Dazu starten wir mit einem kleinen Experiment:
- Bitte betrachten Sie das folgende Bild aufmerksam und überlegen Sie, welche der 4 abgebildeten Personen „neuronormal“ ist/sind und welche „neurodivergent“?

Symbolbild für Vielfalt im Unternehmen: Welche der 4 Personen am Tisch ist „neuronormal“ und wer vielleicht „neurodivergent“?
- …und, wie lautet ihre Antwort? Ist der Mann im T-Shirt neuronormal oder neurodivergent? Und die Frau, die das Bild hochhält, ist sie neurodivergent, oder nicht? Und die beiden anderen Personen auf dem Bild?
- Die Auflösung unseres kleinen Experiments: Ich weiß die Antwort auf die oben gestellte Frage genauso wenig wie Sie. Warum? Na, ganz einfach: Ich kenne die Personen auf diesem Foto genauso wenig wie Sie. Und genauso wenig wie Sie, weiß ich, ob eine der Personen auf diesem Bild in Wirklichkeit ADHS diagnostiziert bekommen hat, oder eine Form von Autismus, oder ob eine dieser Personen hochbegabt ist, oder hochsensibel.
- Und genau das ist der springende Punkt an diesem Experiment: Wir wissen nicht wer „wie“ ist, und wir sehen den Menschen, mit denen wir bei der Arbeit zu tun haben nicht an, wie es in ihnen aussieht, wie ihre Neuronen strukturiert sind und wie ihre Gefühls- und Gedankenwelt aussieht.
Vielfalt in Unternehmen: Ein Thema mit vielen Facetten.

„Vielfalt im Unternehmen“ – das ist ein Thema, mit dem wir uns hier in dieser Artikelserie schon öfter beschäftigt haben.
- Wir haben von den Potenzialen der über 60-Jährigen berichtet.
- Wir haben auch das andere Ende des Altersspektrums betrachtet und von der „Generation Z“ und von Berufsanfängern berichtet und darüber gesprochen, wie der Start ins Berufsleben gut gelingen kann und welche Skills hier wichtig sind.
- Wir haben thematisiert, wie (jungen) Menschen geholfen werden kann, die Therapie- und Beratungsangebote benötigen, und die diese nicht, nicht ausreichend oder nicht schnell genug bekommen.
- Und leider wird auch das Thema „Berufsbedingte Stressbelastung: Wann Arbeit krank macht – und was man dagegen tun kann“ bzw. generell „Stressbelastung reduzieren und Krankheiten verhindern“ immer wichtiger, da immer mehr Berufstätige von beruflicher Stressbelastung in einem Maß betroffen sind, das krank macht.
- Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete und Menschen, die aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, direkten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu finden, brauchen und erhalten ebenfalls spezielle Unterstützung.
- Und auch wenn man vielleicht zuerst einmal denken würde, dass diese spezielle Gruppe doch traumhafte Bedingungen und Zukunftsaussichten haben müsste, ist es tatsächlich auch für Hochbegabte im Berufsleben alles andere als leicht, so dass wir und die Partner aus unserem Netzwerk uns bereits mit den Herausforderungen für Hochbegabte – und für deren Führungskräfte beschäftigt haben.
- Das Thema „Vermeidung von ungerechter Diskriminierung, Fairness und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz“ ist also ein stetiger Begleiter unserer Arbeit und zieht sich wie ein roter Faden durch viele unserer Projekte durch. Gerade die Führungskräfte sind hier oft die Adressaten, da sie großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und die Kultur im Unternehmen haben.
Und genauso wie Menschen verschiedenen Alters, verschiedenen kulturellen Hintergrundes, mit verschiedenen Begabungen und mit unterschiedlich hoher Stressbelastung und Resilienz unterschiedliche Bedürfnisse haben und dem Unternehmen verschiedene Potenziale bieten aber auch verschiedene Herausforderungen stellen, so ist es auch mit neurodivergenten Menschen.
Neurodivergente im Arbeits- und Unternehmensalltag:
Der Anspruch hier soll und kann daher gar nicht sein, dem Thema „Neurodivergenz“ umfassend gerecht zu werden. (Für alle, die tiefer in das Thema eintauchen wollen hier eine Leseempfehlung).
Das Thema soll hier daher ganz pragmatisch vom Ende her gedacht werden, und daher stellt sich die Frage: „Wie kann man sicherstellen, dass alle – egal, wie ihre „Ausgangsbedingungen“ aussehen – die (für sie) optimalen Arbeitsbedingungen bekommen, unter denen sie möglichst ihr volles persönliches Potenzial entfalten können?
1. Bewusstsein schaffen und sensibilisieren
Wichtig ist zunächst einmal, sich bewusst zu werden, dass es bei der Art, wie Menschen denken und handeln und wie sie ihre Umwelt wahrnehmen nicht einfach nur eine Erscheinungsform gibt, sondern eine große Bandbreite. Das ist erst einmal nichts Besonderes, sondern genauso wie bei anderen Attributen.
Nehmen wir als Anschauungsbeispiel und zur plakativen Illustration einmal die Körpergröße: Die meisten Erwachsenen in Deutschland sind zwischen ca. 160 cm und 185 cm groß. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die noch größer oder noch kleiner sind, und die deshalb nicht in diese Kategorie fallen, die für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland zutrifft.

Besonders groß zu sein kann Vorteile haben – zum Beispiel für Profisportler, die als Fußballtorwart oder Basketballspieler*in aktiv sind. Besonders groß zu sein kann aber auch Nachteile haben: Jemand, der 2,05 Meter groß ist, wird vielleicht nicht einfach Möbel (Stühle, Tische, Betten) oder Schuhe „von der Stange“ kaufen können, sondern eine spezielle Maßanfertigung benötigen. Auch der Abstand der Sitzreihen im Flugzeug wird sicher nach anderen Maßstäben berechnet und ist für jemanden, der so groß ist, viel zu eng bemessen. Und die Kehrseite von besonders guten Voraussetzungen, in einer Sportart wie Basketball erfolgreich zu sein, ist vielleicht das erhöhte Risiko für Gelenkschäden und andere körperliche Schwierigkeiten im Alter.
In anderen Sportarten ist es hingegen vorteilhaft, besonders klein und zierlich zu sein (zur Anschauung kann man sich zum Beispiel diese Bildergalerie über die „extremsten“ Olympia-Athleten ansehen).
Bei der Körpergröße ist es – im wahrsten Sinne des Wortes – offensichtlich, bei den Neurostrukturen in unserem Gehirn ist es das nicht, weil sie eben, für andere, aber auch für uns selbst, nicht direkt sichtbar sind: Wir alle unterscheiden uns, mal mehr, mal weniger stark voneinander. Die Folge davon ist, dass wir uns in mancherlei Hinsicht in einer bestimmten Umgebung sehr wohl fühlen und mit ihr besonders gut zurechtkommen, in einer anderen hingegen weniger – genauso wie ein extrem groß gewachsener Basketballprofi auf dem Spielfeld oder in einem engen Flugzeug.
Es ist wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Wir alle sind verschieden, und wir fühlen und unter verschiedenen Bedingungen wohl.
2. Schwierigkeiten und Bedürfnisse erkennen
Aus dieser Tatsache folgt, dass wir alle auch unterschiedliche Bedingungen haben, die wir brauchen, um unsere beste Leistung abrufen zu können. Und das bedeutet, dass eine „typische“ Arbeitsumgebung, beispielsweise ein Büro, das man sich mit anderen teilt, für viele Mitarbeitende einfach „okay“ sein wird, weder besonders toll noch besonders störend. Für einige, denen zum Beispiel soziale Interaktion besonders wichtig ist, ist solch eine Umgebung vielleicht geradezu ideal und unverzichtbar, um mit dem eigenen Potenzial die besten Leistungen bei der Arbeit erbringen zu können. Und für andere wiederum ist solche eine Arbeitsumgebung geradezu „Gift“ und sie können ihr Potenzial unmöglich ausschöpfen, weil sie mit der Geräuschkulisse, mit den vielen Menschen auf engem Raum und mit der Flut an Informationen und Sinneseindrücken nicht gut klar kommen.

Inspirierend, weil man eng mit anderen zusammenarbeitet und Ideen mit ihnen austauschen kann? – oder anstrengend und herausfordernd, weil viele Reize auf einen einstürzen? Die Arbeit in einem modernen Coworking-Space.
Wichtig für die Praxis in den Unternehmen und für gute und erfolgreiche Zusammenarbeit ist daher, nicht einfach anzunehmen, dass das, was für die meisten passend ist, automatisch auch für alle gut ist. Es ist also wichtig, genau hinzusehen – beginnend bei sich selbst und bei den eigenen Bedürfnissen. Man muss herausfinden, was für einen selbst wichtig ist, um auf Dauer gute Arbeit machen und gute Leistungen erbringen zu können. Und genauso wichtig, ist es natürlich, gerade für diejenigen von uns, die Führungsverantwortung in den Unternehmen haben, dass sie sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen.
Selbstreflexion, eine hohe Personenorientierung und vor allem die Prinzipien empathische Führung helfen hier, und tragen dazu bei, den verschiedenen Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gleichzeitig auch den Zielen und Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden.
Was „empathische Führung“ bedeutet und welchen Prinzipien die empathische Führung folgt, das haben wir im Artikel „Empathische Führung muss zum neuen Standard in der Arbeitswelt werden!“ geschildert.
Das ist umso wichtiger, als viele Betroffene Bedenken haben, offenzulegen, wenn sie, zum Beispiel, ADHS oder ADS diagnostiziert bekommen haben – vor allem bei der Arbeit erscheint ihnen das riskant und nachteilig. Und das obwohl ADHS in der öffentlichen Wahrnehmung viel präsenter und anerkannter ist als zum Beispiel Zwangsstörungen.
„Verbaue ich mir da nicht noch irgendwelche Wege? Weil es sind natürlich bestimmte Stereotypen darüber im Umlauf und die da schon mal gelesen haben: Das sind so hibbelige Leute, Struwwelpeter oder so. Aber das bin ich gar nicht. Ich könnte dadurch Überlegungen provozieren oder wachtreten, die ich dann irgendwann auch nicht mehr im Griff habe. Ich bin immer noch derselbe Mensch“, sagt ein Mitarbeiter mit ADS über seine Situation.
Reflexion: Wie ist es bei dir selbst: Bist du denn noch „ganz normal“?
Ein weiterer Aspekt beim Thema „Neurodivergenz“ ist, dass viele „Abweichungen“ vom „Normal“ bei den Betroffenen gar nie diagnostiziert wurden – und wenn, dann oft spät, erst im Erwachsenenalter, beispielsweise, wenn Eltern bei ihren Kindern feststellen, dass diese sich in bestimmten Lebenssituationen schwertun und dann Parallelen zu sich selbst erkennen. Ein aktuelles, prominentes Beispiel dafür ist der Mediziner, Fernsehmoderator, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen. Er hat sich im Zuge einer Reportage intensiv mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt – und im Zuge dieser Recherchen für die Reportage wurde bei ihm selbst auch ADHS diagnostiziert – was ihm eine neue Perspektive auf sich selbst und auf verschiedene Situationen im Beruf und im Alltag ermöglicht. Er selbst sagt zum Thema „Neurodiversität“: „Im Gesundheitswesen gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder man ist krank oder nicht. Im wirklichen Leben gibt es immer ein weites Spektrum von Fähigkeiten und Macken, von Leidensdruck und Laufbahnen. Menschen sind unterschiedlich, vor allem im Kopf. Diese Idee von ‚Neurodiversität‘ finde ich total spannend. Und genau dafür mache ich mich mit dieser Reportage stark.“
Ganz nebenbei: Das Beispiel „Eckhard von Hirschhausen“ zeigt ganz deutlich, dass neurodivergente Menschen, wie zum Beispiel jemand mit ADHS, genauso wie „neuronormale“ sehr erfolgreich und sehr leistungsfähig sein können.
Und gerade diese Tatsache, die in der Diskussion um Neurodivergenz manchmal noch zu sehr untergeht, ist auch ein Grund dafür, warum es höchste Zeit ist, dass sich auch die Arbeitgeber und Unternehmen stärker diesem Thema widmen und öffnen. Denn in Zeiten des extremen Fachkräftemangels finde ich meine zukünftig besten und wertvollsten Mitarbeiter*innen vielleicht genau da, wo ich sie zunächst nicht vermutet hätte (und wo andere, konkurrierende Unternehmen vielleicht noch aus Ignoranz nicht genau hinsehen).
3. Pragmatische, einfache Lösungen suchen
Im Umgang mit Neurodiversität im Unternehmen ist es letztlich wie im Umgang mit anderen Personengruppen und mit den besonderen Herausforderungen, die sich für sie und durch sie ergeben.
Der Grundsatz ist also derselbe. Der große Unterschied in der Praxis ist aber, dass es für andere Gruppen, zum Beispiel für AZUBIS und Berufsanfänger oder für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen in der Regel schon spezielle Unterstützung und entsprechende Programme gibt.
Für Hochbegabte, für Menschen mit ADHS, für Menschen mit Autismus und für andere neurodivergente Personengruppen gibt es solche Programme und Unterstützungsmaßnahmen aber nicht.
Dabei könnten schon Kleinigkeiten viel ausmachen. Ein gutes Beispiel beschreibt :
„Zum Beispiel jemand, der wirklich eine große Reiz-Schwäche hat im Großraumbüro. Der zum Beispiel dann eine extra Kopfhörervorrichtung haben darf. So. Dann ist da vielleicht eine Mama, die wirklich weiß, wenn ich jetzt aus der Arbeit komme, habe ich wieder drei Kinder und so würde es mir auch mal guttun, solche Noise-Cancelling-Sachen zu haben“, sagt Kristina Meyer-Estorf. Sie ist Job-Coach insbesondere für hochsensible, andersbegabte MIT-Menschen aus dem ADHS und Autismus-Spektrum und somit eine echte Neurodiversity-Expertin.
„Für mich ist das Inklusion“, sagt sie: „Wenn die Mama keine Autistin ist, dass sie trotzdem die gleichen Bedingungen haben darf wie der Mensch aus dem Autismusspektrum. Und dass der Autist, der ADHSler nicht extra fragen muss: Weil ich so anders bin, kann ich bitte das und das bekommen?“
Neurodiversität als Herausforderung und Chance in Unternehmen
Für unsere Arbeit in der Personalentwicklung ist Neurodiversität ein wichtiger Aspekt. Fassen wir also zusammen:
- Neurodiversität stellt Unternehmen und Führungskräfte und Mitarbeitenden im Einzelfall durchaus vor Herausforderungen. Diese sind aber nicht so groß, dass sie nicht bewältigt werden könnten.
- Am Ende des Tages ist es aber wie mit anderen individuellen Charakteristiken, zum Beispiel dem Alter, auch: Auch hier gibt es vielleicht besondere Situationen, Herausforderungen, die es zu meistern gilt und Bedürfnisse, die berücksichtigt werden sollten. Wenn man sich die Mühe macht und auf die Bedürfnisse aller eingeht und für die bestehenden Herausforderungen pragmatische, praktikable Lösungen findet, dann ist allen geholfen und alle im Unternehmen können ihre persönlichen Potenziale bestmöglich einbringen und alle im Unternehmen können von den Potenzialen profitieren.
- Wichtig ist dabei, dass es keine „Pauschallösungen“ gibt: Genauso wenig, wie alle Azubis oder alle älteren Mitarbeitenden dieselben Bedürfnisse und Herausforderungen haben, kann man generell für beispielsweise „die ADHSler“ eine bestimmte Maßnahme anbieten, die dann für alle gleich gut funktioniert.
- Auch wenn es mühsam ist: Es kommt immer auf den Einzelfall an. Diesen muss man genau betrachten und man muss sich, wenn man Personalentwicklung und Organisationsentwicklung vernünftig betreiben will, die Mühe machen, auf diesen Einzelfall zu schauen.
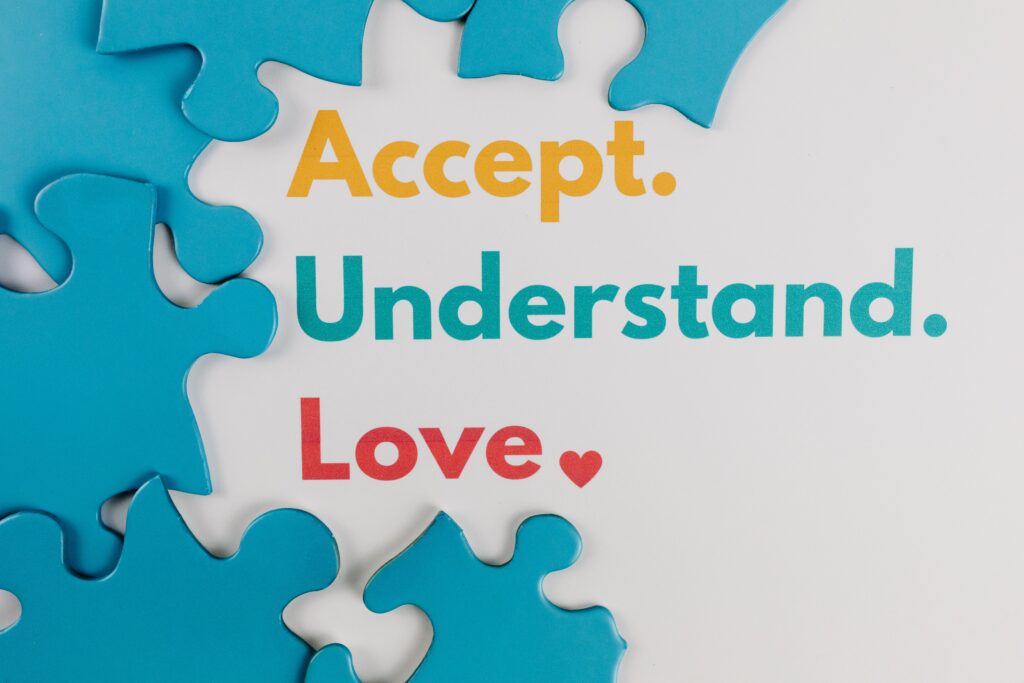
- Und bei diesem Blick auf die konkrete Situation der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Unternehmen insgesamt, da helfen die DNLA-Potenzialanalysen und die dazugehörigen Feedbackgespräche.
- Die Standortbestimmungen und Analyseergebnisse von DNLA, vor allem aber das Feedbackgespräch zu den Ergebnissen, laden zur (Selbst-)reflexion und zum Gespräch miteinander ein.
- Sie bauen Brücken und zeigen, wie die Zusammenarbeit besser gelingen kann.
- Und vielleicht müssen die Beteiligten in diesen Gesprächen vermehrt auch im Hinterkopf haben, dass manchmal, gerade wenn die aus anderen Zusammenhägen bewährten Erklärungsmuster nicht greifen, andere Dinge eine Rolle spielen können als man (der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter) auf den ersten Blick ansieht.
Das alles führt am Ende zu unserem Leitsatz „in jedem Mensch steckt Potenzial“. Oder, anders gesagt: Ein Mensch ist keine Diagnose, sondern ein Wesen mit Stärken, Bedürfnissen und Schwächen. Die Stärken gilt es zu erkennen, zu fördern und zu bewahren und auch die Bedürfnisse und „Schwächen“ gilt es zu erkennen und Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass die Potenziale der Mitarbeitenden möglichst voll zur Geltung kommen.
Die Top HR-Trends 2024 – und was sie für ihre tägliche (HR-)Arbeit bedeuten

Das neue Jahr ist schon wieder einige Tage alt. Höchste Zeit also, auf die HR-Trends 2024 zu blicken: Was erwarten uns den Experten*innen zufolge für HR-Trends 2024? Und noch wichtiger: Was bedeutet das für die Arbeit der HR-Abteilungen im Unternehmen und der externen HR-Spezialistinnen? Welche Herausforderungen kommen auf sie zu? Und was kann helfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern? Darauf blicken wir in diesem Artikel.
[1] Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
KI-Anwendungen werden zunehmend Teil unseres Arbeitsalltags. Das eröffnet Chancen, stellt aber die Menschen und Unternehmen auch vor neue Herausforderungen. In jedem Fall ist KI eine Quelle von tiefgreifenden Veränderungsprozessen.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
- Egal ob im Recruiting oder im Bereich HR-Analytics: KI-basierte Instrumente werden bald verstärkt Teil der Personalarbeit werden. Das eröffnet sicherlich neue Möglichkeiten und macht einige Prozesse effizienter. Andererseits bedeutet es für die Mitarbeiterinnen in den HR-Abteilungen, dass sie sich in die Nutzung der neuen Technologien einarbeiten müssen.
- Wie den Mitarbeitenden in den HR-Abteilungen geht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen: Der regelmäßige Einsatz von KI im Arbeitsalltag ist für die meisten Neuland, weitergehende Entwicklungen, die von einigen prophezeit werden, wie der Einsatz von KI als Führungskraft, hätten sogar noch weitreichendere Konsequenzen.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
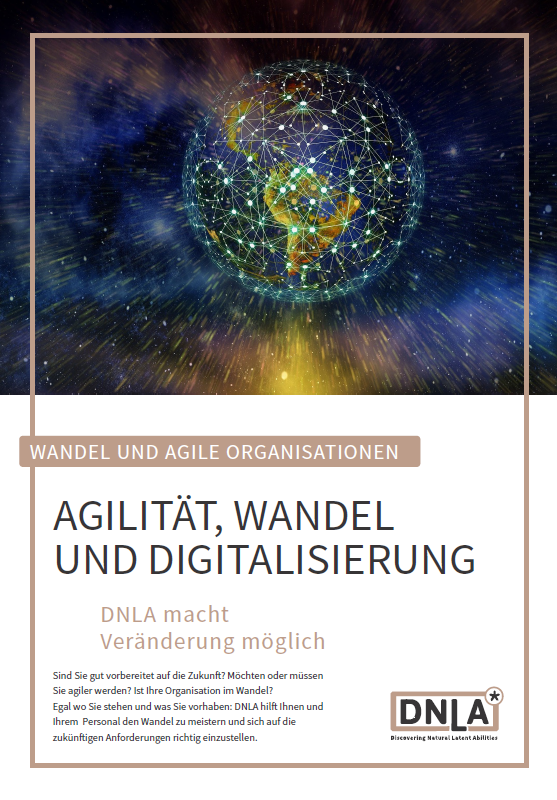
- Auf jeden Fall können diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse nur mit professioneller Begleitung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden gelingen.
- Die DNLA-Analyse- und Entwicklungsinstrumente sind wertvolle Hilfsmittel für das Change Management in Unternehmen.
[2] Die veränderte Rolle der Kandidaten im Recruitingprozess: Unternehmen bewerben sich um Fachkräfte
Fachkräftemangel und größere Möglichkeiten für Bewerberinnen und Bewerber durch moderne Technologien führen dazu, dass wir es mit einem Bewerbermarkt zu tun haben. Die Bewerberinnen und Bewerber begegnen den Unternehmen, die Fachkräfte suchen, also eher auf Augenhöhe als früher. Sie bewerben sich bei den Unternehmen, sie werden außerdem direkt vom Unternehmen angesprochen und egal, von welcher Seite der erste Schritt erfolgt – das Unternehmen muss sich bei den Mitarbeiter*innen in spe bewerben und seine Vorzüge als Arbeitgeber herausstellen.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
- Personalauswahl im heutigen Arbeitnehmermarkt heißt längst nicht mehr nur „ich suche mir ganz einfach die Besten aus“. Personalauswahl heute gleicht viel eher der Suche nach Rohdiamanten: Wer scheint vielleicht im Moment noch nicht so hell, hat aber viel Potenzial, so dass – um in diesem Bild zu bleiben – mit dem richtigen „Schliff“ der ganze Wert sichtbar wird, der in ihm steckt?
- Außerdem rückt das Thema Arbeitgeberattraktivität immer mehr in den Fokus. Und Arbeitgeberattraktivität macht sich nicht an Äußerlichkeiten fest – Mitarbeiterorientierung, Flexibilität, ein motivierendes, attraktives Arbeitsumfeld und vor allem auch fähige Führungskräfte, das alles sind Faktoren, die aus Bewerber*innen und Mitarbeitenden richtiggehend Fans des Unternehmens machen.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
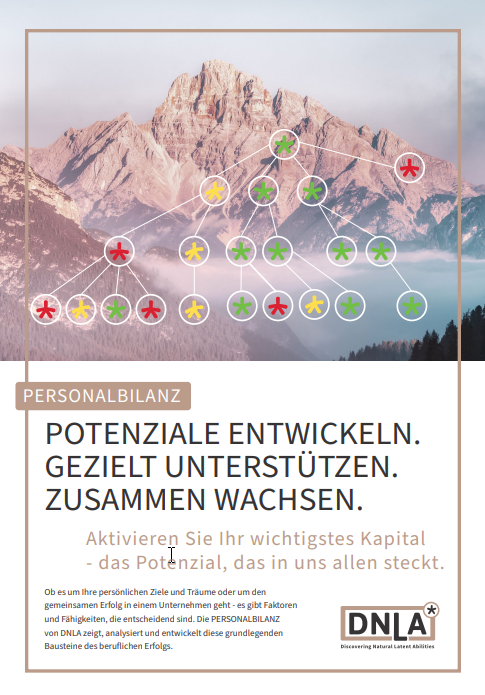
- Potenzialanalyseinstrumente, eingebettet in einen professionellen Feedback- und Beratungsprozess, sind bei der Mitarbeiter*innenauswahl im heutigen Bewerbermarkt von großem Nutzen.
- Und auch wenn es um Mitarbeiterführung, die Stimmung im Unternehmen, ein gutes Klima und um gute Zusammenarbeit geht, sind die verschiedenen DNLA-Instrumente wie DNLA-Management oder die Teamanalyse und natürlich auch die Personalbilanz als Analyseinstrument und als Organisationsentwicklungskonzept sehr hilfreich und verbessern nachweislich die Zusammenarbeit, die Stimmung im Unternehmen und die Unternehmensperformance.
[3] Internationales Recruiting
Der gerade schon angesprochene Fachkräftemangel in Verbindung mit neuen Technologien und Arbeitsformen (hier vor allem: Remote-Arbeit) führt auch dazu, dass die Unternehmen – und zwar nicht nur große Firmen, sondern auch Mittelständler, Handwerksbetriebe und Kleinunternehmen – sich überregional und international auf die Suche nach Fachkräften machen.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
Große Unternehmen, die ohnehin weltweit mit Standorten vertreten sind, sind hier normalerweise gut aufgestellt. Kleineren Unternehmen fehlen aber oft die Zugangswege und die nötigen Mittel, um weltweit Talente zu finden und sie an sich zu binden. Mit den richtigen HR-Partnern wie den Beraterinnen und Beratern aus dem DNLA-Netzwerk als Dienstleistern und den in über 20 Sprachen verfügbaren Analyseinstrumenten aus dem DNLA-Portfolio können sie diesen Nachteil ausgleichen.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
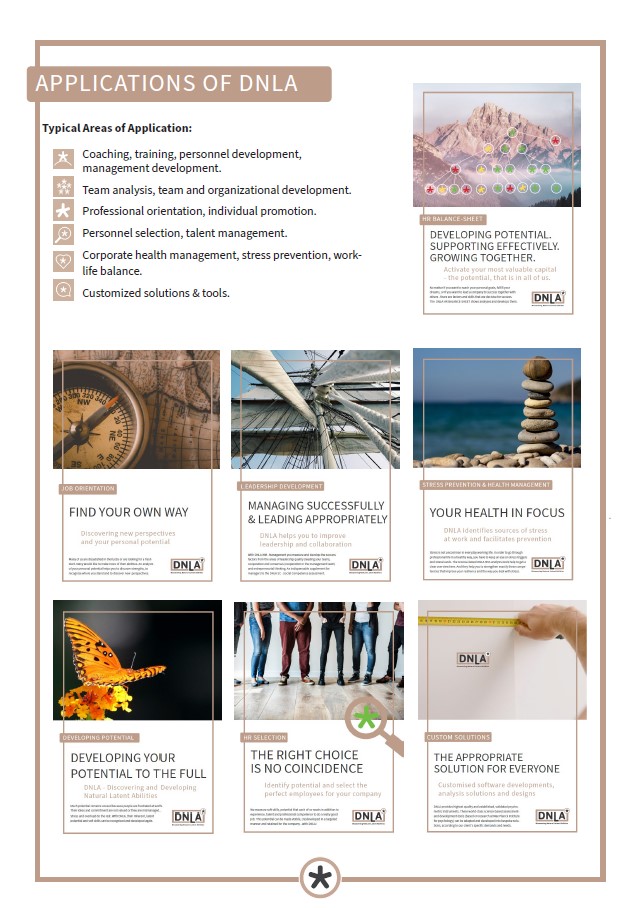
- DNLA bietet ein internationales HR Experten-Netzwerk, mit Partnern in ganz Europa, in Indien, und in anderen Regionen. Mit ihren Dienstleistungen und ihrer Erfahrung unterstützen sie ihre Kunden im Recruiting und in der talent acquisition, im talent development, im internationalen Recruiting und mehr.
- Die DNLA-Verfahren helfen zudem bei der Integration der Mitarbeitenden und bei der Entwicklung von Interkultureller Kompetenz und internationaler Zusammenarbeit.
[4] Fähigkeiten sind wichtiger als formale Bildungsabschlüsse:
Skill Based Hiring und lebenslanges Lernen
Formale Qualifikationen und Abschlüsse sind wichtig, keine Frage. Aber in Zeiten des Fachkräftemangels in denen verstärkt auch Quereinsteiger Chancen bekommen, zählen in vielen Positionen mehr die Skills, die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen, sowie das Potenzial der Bewerberinnen und Bewerber. Das klassische „Degree Based Hiring“, mit Blick auf möglichst gute formale Bildungsabschlüsse wird zunehmend abgelöst vom „Skill Based Hiring“. Das ist gut für die Kandidat*innen, stellt aber die HR im Unternehmen vor einige Herausforderungen.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
Wenn formale Qualifikationen und Abschlüsse an Bedeutung verlieren und es immer stärker darauf ankommt, welche Fähigkeiten die Bewerber*innen aktuell schon mitbringen und welches Potenzial sie in Zukunft besitzen, dann wird es noch wesentlich wichtiger – und schwieriger – sich ein genaues Bild von den Bewerberinnen und Bewerbern zu machen.
Bei den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht die Aufgabe darin, kontinuierlich zu überprüfen, welche (Hard und Soft) Skills schon vorhanden sind, und welche noch (weiter) entwickelt werden müssen und dann entsprechende Bildungsangebote zu machen.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Fachkompetenzen lassen sich meist relativ einfach erkennen und überprüfen. Beim Einschätzen von Bewerber-Potenzialen, bei allen Soft Skills aus dem Bereich der Sozialen Kompetenz, beim Führungspotenzial und bei Meta-Faktoren wie „Lernfähigkeit“ oder „Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft (Adaptabilität)“ sind die Potenzialanalysen von DNLA – Discovering Natural Latent Abilities Gold wert. Sie erlauben einen objektiven Blick auf bereits vorhandene und auf künftige Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten und kommen daher in der Bewerberauswahl im Talent Management, im Coaching und bei der beruflichen Neuorientierung zum Einsatz.
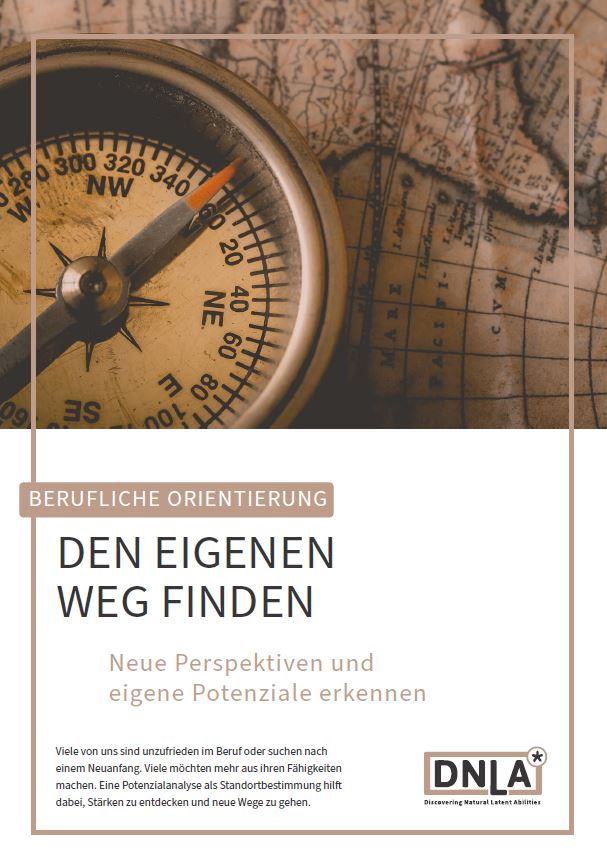
- Dementsprechend profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen von den DNLA-Analysen: Auch Existenzgründer und Menschen in einer Phase der beruflichen Neuorientierung profitieren von einer Standortbestimmung und Beratung mit DNLA.
[5] Blended Workforce und Flexible Arbeit: Eine Mischung aus unterschiedlichen Arbeitsmodellen bleibt beliebt
Flexibilität ist Trumpf – das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie für die Unternehmen. Die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitsformen (remote, von unterwegs oder von zuhause aus, kombiniert mit arbeiten in Präsenz) und Arbeitsmodellen (Vollzeit, Teilzeit, als Freelancer*in, …) ist daher ein wichtiges Kriterium für Arbeitssuchende bei der Wahl ihres nächsten Arbeitgebers.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
Um den verschiedenen Bedürfnissen und Lebenssituationen der Mitarbeitenden gerecht zu werden, werden die meisten Firmen, bei denen das möglich ist, beide Arbeitsformen anbieten (müssen): Arbeiten in Präsenz und remote. Die Vielfalt der Arbeitsformen und -modelle hat unbestreitbar Vorteile. Sie stellt aber auch neue Herausforderungen, gerade in den Bereichen Arbeitsorganisation, Teamzusammenhalt und Teamintegration. Und auch die Führungskräfte müssen sich und ihre Rolle in einer geänderten Arbeitswelt anpassen und neu definieren.
- Für die Personaler*innen und für die Führungskräfte stellt sich verstärkt und in anderer Weise als früher die Aufgabe der Integration der einzelnen Teammitglieder.
- Außerdem muss das Unternehmen seinen Beitrag dazu leisten, dass das Arbeitsumfeld auch am Remote-Arbeitsplatz für Wohlbefinden sorgt. Und es muss Regeln definieren, die sicherstellen, dass die verschiedenen Arbeitsformen nicht zu Stress, erhöhter Belastung und Selbstausbeutung führen.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
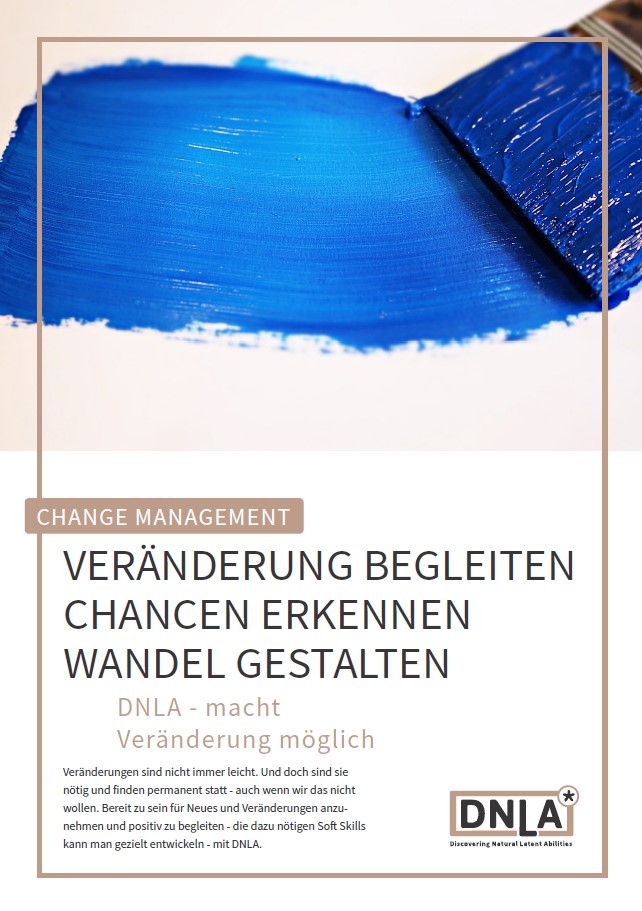
- Mit DNLA haben die HR-Verantwortlichen im Unternehmen ein wunderbares Set von Instrumenten in der Hand, um Überlastung und Überforderung, Identifikations- und Motivationsprobleme, erste Anzeichen von berufsbedingter (oder auch anderweitig verursachter) ungesunder Stressbelastung und andere Probleme frühzeitig zu erkennen.
[6] Altersdiverse Belegschaften; Diversität ermöglichen, Inklusion erreichen.
Stärker als früher treffen in Zukunft verschiedene Alterskohorten und „Generationen“ im Unternehmen aufeinander. Unterschiedliche Erfahrungen, Prägungen, Präferenzen und Werthaltungen der „Generation X“, „Generation Y“, „Generation Z“ und der Generation Alpha“ stellen auch die HR im Unternehmen vor neue Herausforderungen.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
Es geht um das Management von altersdiversen Belegschaften und darum, die Potenziale der Mitarbeitenden optimal zu nutzen.
- Auch hier geht es ein weiteres Mal um das Thema Integration. Es reicht nicht, einfach Personen auszuwählen, die die verschiedenen Aufgaben im Unternehmen fachlich bestmöglich erfüllen können. Um aus den verschiedenen Individuen ein funktionierendes Ganzes zu schaffen, so dass etwas entsteht, das größer ist als die Summe der „Einzelteile“, braucht es gemeinsame Werte und Ziele und ein gemeinsames Verständnis davon, wofür das Unternehmen stehen soll und welche Prinzipien für das Handeln des Unternehmens, zum Beispiel gegenüber den Kunden oder gegenüber der Gesellschaft, wichtig sind.
- Und nicht nur die Altersdiversität der Belegschaften, auch Diversity, Gleichstellung und Inklusion generell als wichtige HR Themen gewinnen an Bedeutung für die Personalarbeit.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
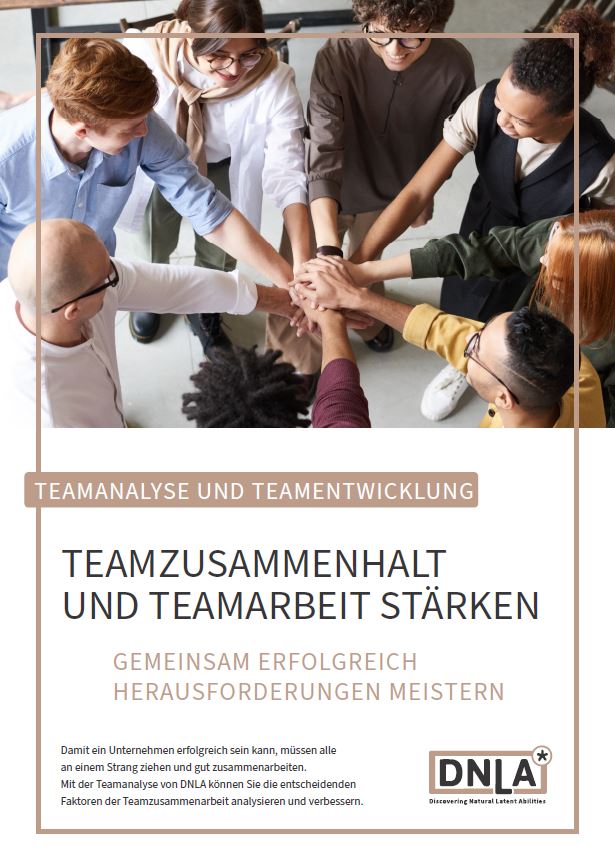
- Die verschiedenen DNLA-Instrumente wie das Erfolgsprofil Soziale Kompetenz helfen dabei, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen genau die Förderung und die Impulse zu geben, die sie für eine optimale persönliche und berufliche weitere Entwicklung brauchen. Vielfalt und unterschiedliche Ausgangsbedingungen sind somit also kein Problem mehr, sondern ein Trumpf.
- Die DNLA-Verfahren mit ihrer gesamten Ausrichtung und im speziellen auch mit Aspekten wie Gender- und Diversitykompetenz sind wertvolle Werkzeuge zur Förderung von Diversity und Gleichstellung am Arbeitsplatz.
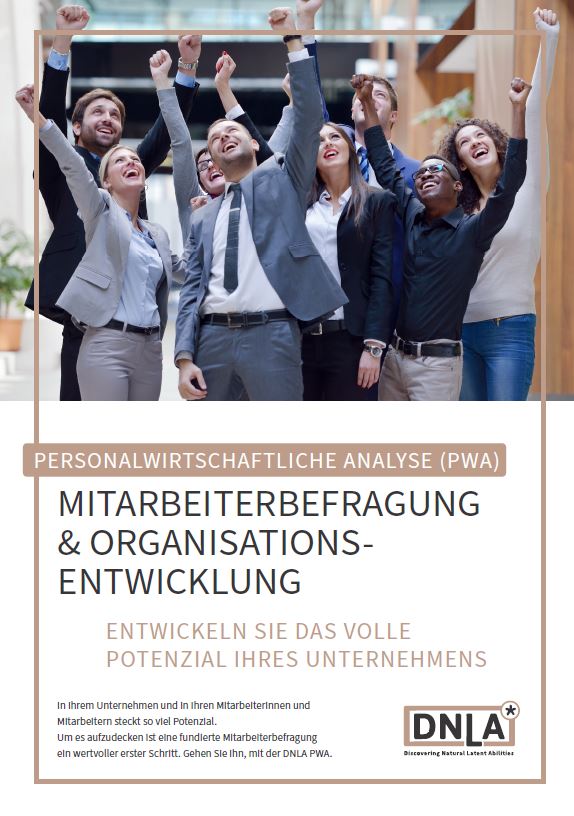
- Insbesondere mit der DNLA-Teamanalyse gelingt es, Reibungspunkte und Probleme in der Zusammenarbeit frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die DNLA-Teamanalyse hilft dabei, gemeinsame Werte, Ziele und Perspektiven zu entwickeln und aus Spezialist*innen mit Talenten unterschiedlichster Art echte, funktionierende Teams zu machen.
- Mit Hilfe der Mitarbeiterbefragung DNLA PWA können ebenfalls unterschiedliche Standpunkte sowie Bereiche im Unternehmen, bei denen noch Handlungsbedarf herrscht, sichtbar gemacht werden.
[7] Die Bedeutung der Employee Experience und der Faktor „B“ wie „Belonging“: Wie die Mitarbeitenden ihr Unternehmen positiv erleben
Die Employee Experience hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erhalten. Die Employee Experience ist die Summe aller Erfahrungen, Interaktionen, Eindrücke und Emotionen, die die Mitarbeitenden mit ihrem Unternehmen sammeln – von der Bewerbungsphase und dem ersten Arbeitstag an bis zum letzten Arbeitstag und darüber hinaus.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
Ein positives Arbeitsumfeld hat einen wesentlichen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter (Employee Wellbeing) – und damit auch auf deren Loyalität, Motivation, Engagement und Produktivität und auf die Mitarbeiterzufriedenheit.
Wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dann geht es nicht nur darum, wie das Unternehmen nach innen und außen auftritt und darum, wie es kommuniziert und all die anderen Faktoren, die für die Arbeitsumgebung und die Atmosphäre am Arbeitsplatz wichtig sind – es geht auch um die Haltung und die Werte aller im Unternehmen. Diversity, Equity und Inclusion als Akronym DEI kennen wahrscheinlich viele. Zu „DEI“ kommt nun noch „B“ wie „Belonging“ als ein weiterer wichtiger Aspekt der Personalarbeit.
„Belonging“ beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit am Arbeitsplatz. Es geht um eine Kultur am Arbeitsplatz, die die Mitarbeitenden in ihrer Individualität anerkennt und wertschätzt. Unternehmen, denen es gelingt, eine Kultur zu schaffen, in der Mitarbeiter ihre Individualität anerkennen und schätzen können, sind sehr attraktiv als Arbeitgeber.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
Anerkennung und Wertschätzung der Vielfalt und Individualität der Mitarbeiter, Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Wertschätzung, gute Führung und gute Zusammenarbeit – die Instrumente von DNLA und die Arbeit, die die Beraterinnen und Berater sowie die Personaler*innen in den Unternehmen damit leisten fördern all diese Dinge in vielfältiger Weise.
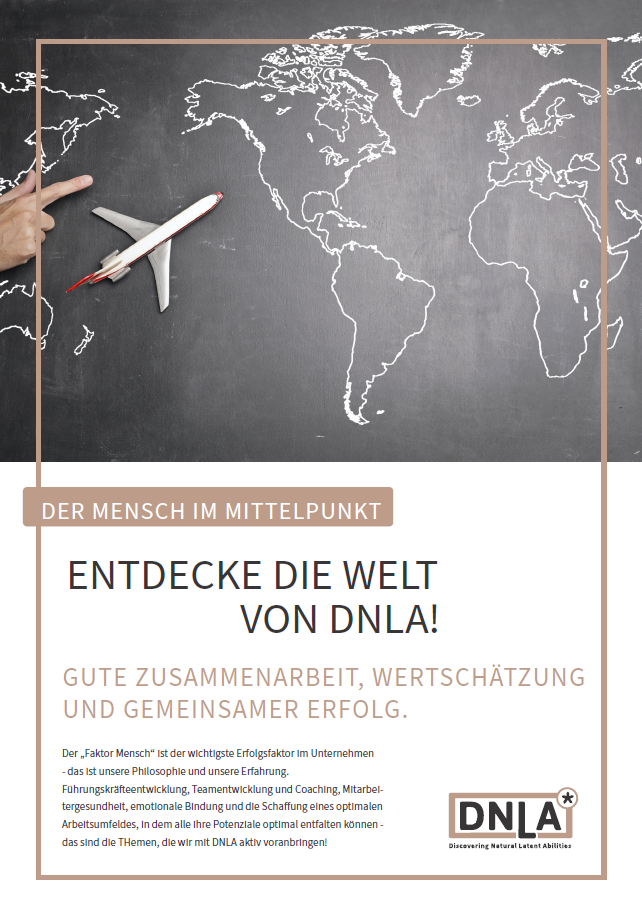
- Mit dem Thema „Was uns bei der Arbeit glücklich macht“ haben wir uns schon sehr sehr oft beschäftigt – in den Artikeln und Textbeiträgen hier auf der Seite, vor allem aber in der täglichen Arbeit, die wir und vor allem unsere DNLA-Partner jeden Tag in den Unternehmen leisten.
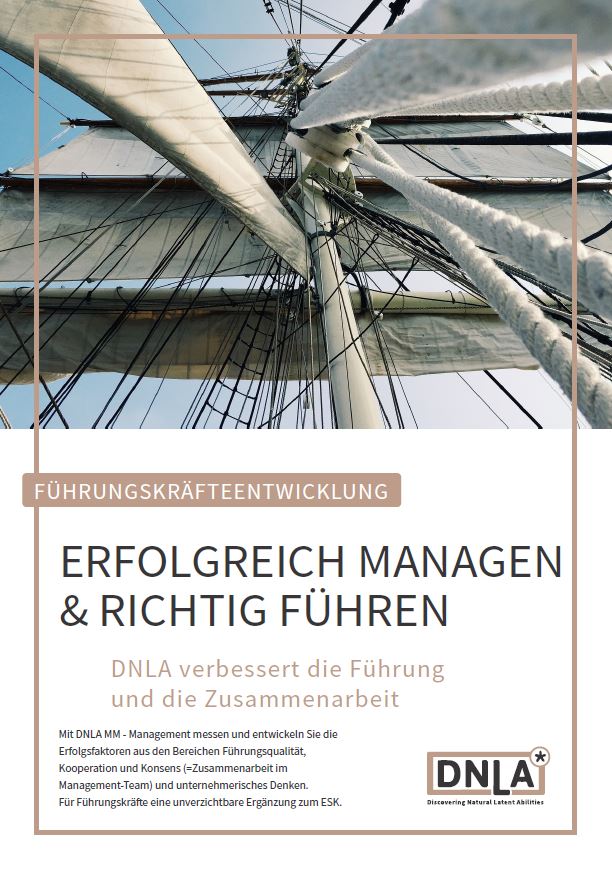
- Gute Arbeitsbedingungen, gute Führung(skräfte) und ein Umfeld am Arbeitsplatz, das dazu beiträgt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen ihr Potenzial voll entfalten können – das ist ein Kernthema ganz vieler unserer Projekte.
- Wenn möglich gehen wir dabei Top-Down vor und beginnen mit der (Organisations-)entwicklungsarbeit bei den Führungskräften, denn diese haben entscheidenden Einfluss für die Kultur im Unternehmen, die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag.
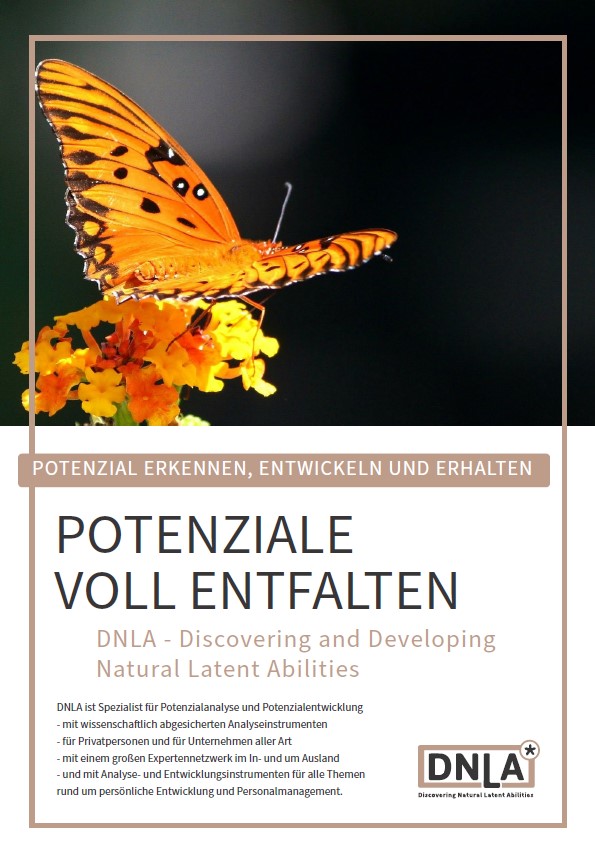
- Auch die Mitarbeitenden sollen möglichst alle Zugang zu einer Standortbestimmung mit DNLA und zu individueller Förderung erhalten.
- So schaffen wir Schritt für Schritt Arbeitsbedingungen, die es allen ermöglichen, ihr individuelles Potenzial möglichst voll zu entfalten und so zusammenzuarbeiten, dass gemeinsame Ziele erreicht werden und gemeinsame Erfolge gefeiert werden können.
- Und all das steigert wiederum auch die Mitarbeiterbindung, das Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen, die Loyalität und Mitarbeiterbindung.
[8] Wirtschaftlicher Druck: HR-Arbeit als messbarer wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.
All diese Entwicklungen spielen sich in einem Umfeld ab, das von Unsicherheit, von Krisen und Katastrophen und unvorhergesehenen, tiefgreifenden Veränderungen in der Welt geprägt ist. Eine Konsequenz daraus für nahezu alle Unternehmen ist wirtschaftliche Unsicherheit und wirtschaftlicher Druck.
Was bedeutet das für die HR-Arbeit?
- Die HR-Abteilung im Unternehmen muss noch mehr als bisher klar machen, dass sie Werte schafft und dass sie ein Treiber von wirtschaftlicher Entwicklung und von greifbaren Mehrwerten im Unternehmen ist.
- Daher gewinnt auch der Bereich HR-Analytics immer mehr an Bedeutung: Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es Unternehmen, umfassend Daten mit HR-Bezug zu sammeln und zu analysieren. HR-Analytics geht dabei über herkömmliche HR-Praktiken hinaus, indem es moderne Datenanalyse- und KI-Technologien nutzt, um tiefergehende Einblicke in verschiedene HR-Bereiche zu gewinnen. Von der Optimierung von Recruiting-Prozessen über die Identifizierung von Leistungstrends bis hin zur Vorhersage von Mitarbeiterbedürfnissen – HR-Analytics ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, die die Effizienz steigern und das Mitarbeitererlebnis verbessern.
Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?
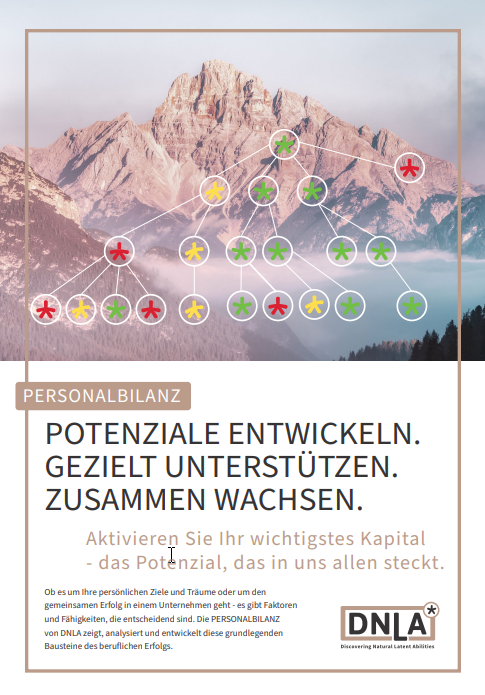
- Die DNLA-Verfahren zeigen Bereiche auf, in denen ungenutzte Potenziale liegen, sie liefern Entwicklungsimpulse und sie machen Veränderungen und Potenzialzuwachs sichtbar, auch das auch in Bereichen, die sonst schwer zu greifen wären.
- Das gilt insbesondere auch für die Personalbilanz von DNLA.
- Mit unseren Instrumenten und mit der Beratung auf Basis der DNLA-Daten erhöhen und sichern wir langfristig und auf Dauer die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden im Unternehmen.
- All das ermöglicht die Kompetenzfortschrittsmessung und ein professionelles Kompetenzmanagement im Unternehmen.
Alle HR-Trends 2024 zeigen: Der „Erfolgsfaktor Sozialkompetenz“ und die systematische Entwicklung von Mitarbeiterpotenzialen (und damit automatisch auch des Potenzials, das im gesamten Unternehmen steckt) werden wichtiger denn je. Denn Zustände wie in der Vergangenheit und bis heute, mit dauerhaft niedrigen Werten in emotionaler Bindung und mit hoher Unzufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Führungskräften in den Unternehmen und den daraus resultierenden Einbußen in Sachen Motivation, Engagement und Produktivität sind für die Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen noch kritischer und noch weniger tragbar als bisher, ja, sie können sogar über die „Überlebenschancen“ und Zukunftsperspektiven des Unternehmens mit entscheiden.
Das haben Sie sich verdient – Alternativen zu Dienstwagen und zu mehr Bruttogehalt
Viele Unternehmen möchten gute Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belohnen. Das aber richtig zu machen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Was an den „Klassikern“ Dienstwagen und Gehaltserhöhung durchaus problematisch ist und wie man es besser machen kann, so dass mit weniger finanziellem Aufwand mehr „Belohnungswirkung“ bei den Mitarbeitenden ankommt, das zeigen wir hier.

„Wenn das Sparschwein Urlaub hat…“ …warum „mehr Geld“ für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber nicht immer das ist, was auch am besten als Belohnung wirkt – und welche Alternativen es gibt.
Mitarbeiter belohnen – heute wichtiger denn je.
Mitarbeiterbindung – in Zeiten des Fachkräftemangels ein Thema, das die Verantwortlichen in den Unternehmen stets beschäftigt. Ein Mittel, um sich das Wohlwollen und die Loyalität der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern, sind sicher Belohnungen und Incentives.
Jemanden für gute Leistungen belohnen – eine ganz einfache Sache. Oder etwa doch nicht?
Die häufigsten Fehler beim Mitarbeiter belohnen
Leider kann man einiges falsch machen, wenn man Mitarbeiter belohnen will. Die zwei häufigsten Fehler:
- 1. Man belohnt an den Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbei.
Ein schicker Dienstwagen – sieht gut aus, aber ist es auch das, was dem Mitarbeiter wirklich gefällt? Kann er ihn wirklich gut nutzen? Ist es das, was ihn motiviert? Im schlimmsten Fall geht man von falschen Voraussetzungen aus und erzielt dann eine geringe oder sogar enie negative Belohnungswirkung. - 2. Man wählt zwar die richtige Belohnung, aber nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen aufwenden muss, kommt auch bei den Mitarbeitern an.
Das gilt insbesondere für Lohnerhöhungen. Hier wird das Mehr an Bruttogehalt durch Steuern und Abgaben geschmälert und das, was netto noch bei den Mitarbeitern ankommt, ist deutlich weniger als das, was das Unternehmen ausgeben muss.
Im Extremfall kann eine Lohnerhöhung sogar per Saldo eine negative finanzielle Wirkung für den Mitarbeiter haben, wenn sich für diesen durch die Lohnerhöhung der Steuersatz erhöht – das Problem der Steuerprogression. Dann würde von der Lohnerhöhung nur der Staat profitieren und sonst niemand.
Auch andere Ausgaben und finanziellen Belastungen könnten durch eine Lohnerhöhung zunehmen. Kitabeiträge zum Beispiel werden in der Regel gestaffelt nach dem Einkommen der Eltern festgesetzt. Und wenn man eine gewisse Gehaltsgrenze überschreitet, dann steigen die Beiträge.
Der Effekt ist, dass man unnötig Geld „verbrennt“ oder zumindest mit den eingesetzten finanziellen Mitteln nicht die gewünschte, optimale Belohnungswirkung erzielt. Eine „lose-lose“-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen.

Symbolbild: Viel Geld – wenig Wirkung.
Mitarbeiter belohnen: So kann man es besser machen
Zunächst einmal zu alternativen Möglichkeiten, Mitarbeitern einen materiellen Mehrwert zu bieten:
1. Förderung von Gesundheitsmaßnahmen
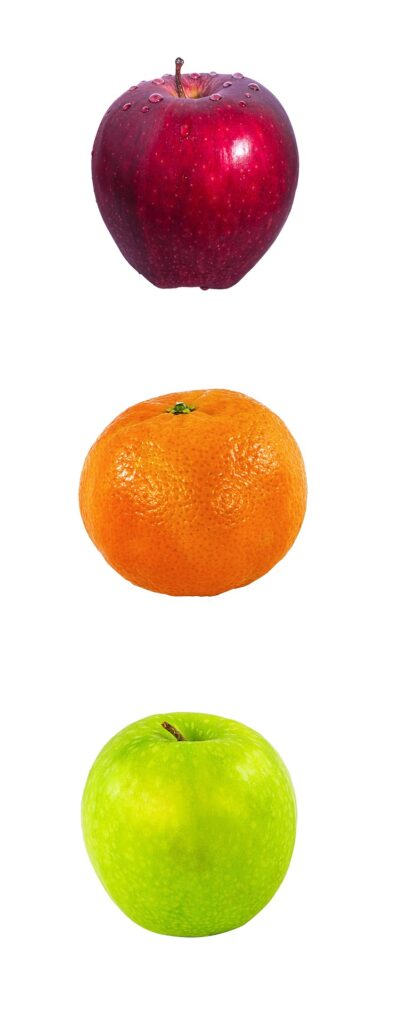
Viele betriebliche Gesundheitsmaßnahmen, aber auch Kosten für Sportkurse oder den Besuch eines Fitnessstudios können gefördert werden. Wenn der Arbeitnehmer einen Teil der Kosten übernimmt, dann kann er dies in einer Höhe von 500,- EUR pro Jahr tun, ohne Steuern oder Sozialabgaben zahlen zu müssen. Dies gilt für alle Maßnahmen und Präventionsprogramme, die der Verbesserung oder Erhaltung des eigenen Gesundheitszustandes dienen.
2. Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege; Übernahme von Kindergartenbeiträgen
Unternehmen können die Kindergartenbeiträge ihrer Angestellten übernehmen, ohne dass diese dieses zusätzlich zum Lohn gezahlte Geld versteuern müssen. Und da die Beiträge für die Betreuung in der Krippe, im Kindergarten oder in der Kita und für die Verpflegung der Kinder sehr teuer sein können, ist dieser steuerfreie „Zusatzlohn“ für Eltern sehr attraktiv.

Ähnlich angelegt, allerdings nur für kurzzeitige „Notsituationen“ vorgesehen ist die Möglichkeit, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter unterstützen, indem sie Kosten für Babysitter oder, wenn die Mitarbeiter pflegebedürftige Angehörige versorgen, für die Pflegekräfte, in den Fällen übernehmen, in denen die Mitarbeiter kurzfristig bei der Arbeit benötigt werden, beispielsweise, weil eine wichtige Messe ansteht und ein Kollege ausgefallen ist. Bis zu 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter darf das Unternehmen steuerfrei für Dienstleister wie Pflegekräfte oder Babysitter bezahlen, die dann Kinder unter 14 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige kurzfristig betreuen.
3. Arbeitsmittel, Technik
Technische Geräte, die für die Arbeit, aber auch privat genutzt werden können, wie zum Beispiel Laptops oder Mobiltelefone werden steuerlich ebenfalls günstiger behandelt als der Monatsarbeitslohn. Das Unternehmen zahlt auf solche Anschaffungen pauschal 25% Steuern, für die Arbeitnehmer sind sie steuerfrei.
4. Mobilität fördern: Dienstwagen, Dienstfahrrad, Fahrtkostenzuschuss, Bahn Card
Die meisten Möglichkeiten, den eigenen Mitarbeiter*innen etwas Gutes zu tun und dabei Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu sparen gibt es im Bereich Mobilität:
4.1: Fahrtkostenzuschuss und Jobticket
Günstig für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind auch Zuschüsse für die täglich anfallenden Fahrten ins Büro. Der Arbeitgeber kann so die Fahrten der Mitarbeitenden mit dem privaten PKW mit 30 Cent pro Kilometer steuerfrei bezuschussen.

Benutzt der Mitarbeiter öffentliche Verkehrsmittel, kann der Arbeitgeber auch diese Kosten übernehmen bzw. bezuschussen. Für den Arbeitnehmer ist diese Form des Arbeitslohns ebenfalls steuerfrei, der Arbeitgeber zahlt pauschal 15% Steuern auf diese Beträge und kommt somit günstiger weg als wenn Steuern und Abgaben auf den Arbeitslohn zu zahlen sind.
Außerdem kann der Arbeitgeber Monats- oder Jahreskarten der Verkehrsunternehmen für die Mitarbeiter*innen erwerben und diese unentgeltlich oder verbilligt an diese weitergeben. Auch das ist steuerfrei.
4.2 Bahncard

Unternehmen können den Mitarbeitenden eine Bahncard für die private Nutzung überlassen. Das ist dann rechtens, wenn die Bahncard für dienstliche Fahrten zum Einsatz kommt und wenn dadurch der Nutzen, der durch geringere Kosten für die Dienstreisen mit der Bahn entsteht, die Kosten für die Anschaffung der Bahncard übersteigt.
Ist das erfüllt, dann darf der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dieselbe Bahncard auch für private Fahren steuerfrei nutzen.
4.3 Dienstwagen und Jobfahrrad
Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Die Überlassung des Dienstwagens für die rein berufliche Nutzung ist steuer- und sozialversicherungsfrei.
- Wenn der Dienstwagen auch privat genutzt wird, dann muss entweder ein Fahrtenbuch geführt werden, um zu dokumentieren, wie groß der private und wie groß der dienstliche Anteil der Dienstwagennutzung ist. Oder aber die Mitarbeitenden müssen ihren geldwerten Vorteil monatlich mit einem Prozent des Bruttolistenpreises des Dienstwagens (bei Elektroautos wird´s unter Umständen etwas günstiger – dann fallen nur 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises angesetzt werden) versteuern.
- Bei JobRad als Gehaltsextra trägt der Arbeitgeber die kompletten Kosten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Seit dem 1. Januar 2019 sind diese Jobräder für Mitarbeiter steuerfrei (der geldwerte Vorteil ist nicht zu versteuern).
5. Fortbildungen

Unternehmen können Fortbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen sponsern. Diese sind komplett steuer- und abgabenfrei – vorausgesetzt, sie haben Bezug zur Arbeit der Mitarbeitenden und führen dann dazu, dass die Mitarbeitenden besser oder vielfältiger einsatzbar sind.
6. Finanzielle Unterstützung, Darlehen
Manchmal braucht man für unvorhergesehen mehr Geld als man noch in Reserve hat, etwa wenn das Auto kaputt ist und ein neues angeschafft werden muss. Oder das Konto ist öfter in den Miesen und man muss hohe Dispozinsen bezahlen. Eine kostengünstigere Alternative zum Bankkredit kann dann ein Arbeitgeberdarlehen sein. Der Arbeitgeber kann Mitarbeitern zinsgünstig oder sogar zinsfrei bis zu 2.600 Euro leihen, ohne dass dabei Steuern oder sonstige Beiträge fällig werden. Erst bei höheren Darlehen werden in einem gewissen Umfang Steuern auf die Differenz von marktüblichem Zins und effektiv gezahlten Zins fällig.
Zusammengefasst: Materielle Vorteile für die Mitarbeiter*innen
Mobilität, Weiterbildung, Mitarbeitergesundheit und Unterstützung bei familiären und bei finanziellen Notsituationen – der Staat fördert und begünstigt also Dinge, von denen die Mitarbeitenden, die Arbeitgeber und insgesamt gesehen auch die Gesellschaft profitieren.
Die genannten Leistungen sind also gute Alternativen zu einer Erhöhung des Bruttoarbeitslohns und somit finanziell und auch von der Motivationswirkung her vorteilhafter.
Es gibt aber noch weitere Aspekte, die zu beachten sind, um die Mitarbeiter*innen wirklich richtig zu belohnen und damit die maximale Belohnungswirkung zu erzielen.
Unerlässlich, um Mitarbeiter richtig zu belohnen: Die Motivation der Mitarbeiter kennen:
Denn manchmal ist der gesamte Bereich der geldwerten Vorteile und der materiellen Anreize gar nicht der, der auf der persönlichen Prioritätenliste der Mitarbeitenden ganz oben steht. Wenn Vorgesetzte dies vermuten, dann kann das falsch sein, manchmal schließen diese vielleicht zu schnell von sich auf andere.
Wie aber kann man herausfinden, ob materielle Anreize die größte Motivationswirkung entfalten, oder ob nicht andere Dinge in Sachen Motivation eine viel größere Rolle spielen?
Eine Möglichkeit, genau dies zu tun, bieten die Analyseverfahren von DNLA – Discovering Natural Latent Abilities, konkret die Analyse DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz.
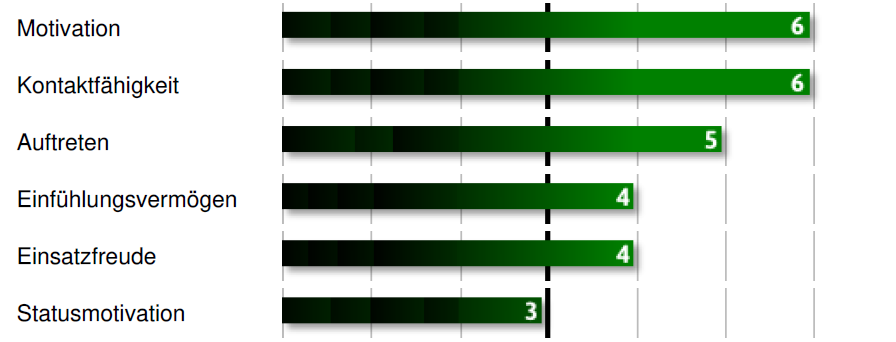
Abbildung: Ausschnitt aus einer Teilnehmerauswertung DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz.
Auffallend hier ist, dass der Faktor „Motivation“ (gemessen wird hier die intrinsische Motivation) sehr stark ausgeprägt ist, der Faktor „Statusmotivation“ (bei dem es um verschiedene Arten von materiellen und extrinsischen Anreizen geht) jedoch deutlich geringer und auch unter dem Durchschnitt der erfolgreichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Berufsgruppe.
Was aber, wenn – wie hier – extrinsische Anreize viel weniger wichtig für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter sind, verglichen mit den Dingen, die die intrinsische Motivation befeuern?
Werfen wir also noch einen genaueren Blick auf diesen Bereich:
Wertschätzung, sinnvolle Aufgaben und mehr – Elemente der intrinsischen Motivation.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Eine ausreichende und faire Bezahlung ist immer wichtig. Die Dinge, die wir hier gerade diskutiert haben, gehören ja in den Bereich zusätzlicher materieller Leistungen über diesen ohnehin selbstverständlich notwendigen Rahmen hinaus.
Und genau dieses über das normale Maß hinausgehende muss nicht unbedingt materieller Art sein.
Andere Dinge können für die einzelne Mitarbeiterin oder den einzelnen Mitarbeiter unter Umständen wichtiger sein und daher für sie eine individuell größere Belohnungswirkung entfalten.
Dies könnten zum Beispiel sein:
- Berufliche Perspektiven, Aufstiegschancen. Diese könnten zum Beispiel greifbar werden dadurch, dass die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter in ein internes Talent Management Programm aufgenommen wird.
- Flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsformen, Flexibilität des Arbeitsortes. Auch Flexibilität, Vertrauensarbeitszeit, unkomplizierte Home-Office-Regelungen und überhaupt jegliche Form von Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmung werden heute von sehr vielen Mitarbeitenden sehr geschätzt und können gerade angesichts familiärer Verpflichtungen „Gold wert“ sein.
- Mitbestimmung bei den Arbeitsinhalten, eigene Projekte: Wer vermehrt über die eigenen Arbeitsinhalte mitbestimmen kann, wird dies nicht nur als Signal der Wertschätzung und als Vertrauensbeweis erleben, sondern auch als echte Belohnung empfinden: Wenn man sich verstärkt die Arbeitsinhalte und Projekte aussuchen kann, an denen man am meisten Spaß hat, dann stärkt das die Motivation und die innere Bindung.
Fazit: So belohnen Sie richtig
Man sieht: Das Thema „Mitarbeiter belohnen“ ist komplexer als es auf den ersten Blick erscheint. Es lohnt sich, über die Ausprägung und Stärke der extrinsischen Motivation und der intrinsischen Motivation Bescheid zu wissen und auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einen Dialog zu treten: Was genau ist für Sie ein greifbarer Mehrwert? Was stellt einen wirklichen Anreiz, eine Belohnung dar und was nicht? Wenn man sich diese Mühe macht, dann wird man mit wenig viel erreichen:
Ein wenig Zeit, ein wenig Aufmerksamkeit und Orientierung an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden, dazu dann die Dinge, die von jemandem wirklich als Belohnung und als Signal der Wertschätzung empfunden werden – mehr braucht es gar nicht und man wird das, was man hier investiert hat in Form von Loyalität und guter Leistung zurückgezahlt bekommen.
Fokussierung auf HR-Exzellenz: Die Rolle der digitalen Fotografie im Talentmanagement
In der sich rasch wandelnden Geschäftswelt von heute ist es für Human Resources (HR) unerlässlich, innovative Strategien zu implementieren, um Talente effektiv zu managen und zu fördern. Eine unerwartete, aber leistungsstarke Ressource, die HR-Profis in diesem Bestreben unterstützen kann, ist die Digitalfotografie. Durch visuell ansprechende Darstellungen können HR-Teams die Unternehmenskultur bereichern, die Kommunikation verbessern und ein lebendiges Portfolio des Talentpools eines Unternehmens erstellen. Dieser Artikel beleuchtet, wie die Digitalfotografie als effektives Werkzeug in verschiedenen Bereichen des Talentmanagements eingesetzt werden kann.
Die Essenz des Talents einfangen: Fotografie in Mitarbeiterportfolios nutzen

Ein gut gestaltetes Mitarbeiterportfolio kann eine authentische Darstellung der Fähigkeiten, Erfahrungen und des Charakters eines Individuums bieten. Digitalfotografie spielt hierbei eine zentrale Rolle. Professionelle Porträtfotos können dabei helfen, ein klares Bild des Mitarbeiters zu vermitteln und einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Zudem können Fotos von Mitarbeitern bei der Arbeit oder bei Teamveranstaltungen die Zusammenarbeit und die Unternehmenskultur in einer authentischen und ansprechenden Weise darstellen.
Darüber hinaus können Fotoprojekte als Teambuilding-Übungen dienen und gleichzeitig wertvolles visuelles Material für interne und externe Kommunikationsinitiativen bereitstellen. Mitarbeiter können durch die Erstellung von visuellen Portfolios, die ihre beruflichen Reisen und Erfolge dokumentieren, auch ein Gefühl der Anerkennung und des Wertes erfahren.
Ein makelloser Einarbeitungsprozess: Die Rolle der Digitalfotografie bei der Einführung neuer Talente
Die ersten Tage eines neuen Mitarbeiters sind entscheidend für dessen langfristige Bindung und Erfolg im Unternehmen. Ein visuell ansprechend gestalteter Einarbeitungsprozess kann eine einladende und unterstützende Umgebung schaffen. Digitalfotografie kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen: Durch professionelle Fotografien des Arbeitsplatzes, der Teams und der Unternehmenskultur können neue Mitarbeiter ein klareres Bild von ihrem neuen Umfeld erhalten.

Fotos können auch verwendet werden, um wichtige Unternehmensereignisse, Meilensteine oder Teamaktivitäten zu dokumentieren und den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Geschichte und die Werte des Unternehmens besser zu verstehen. Darüber hinaus können fotografische Dokumentationen von Arbeitsprozessen oder sicherheitsrelevanten Verfahren eine visuelle Unterstützung für Schulungen und Einführungsprogramme darstellen, die den Lernprozess erleichtern und beschleunigen.
Momentaufnahmen: Verbesserung von Leistungsbewertungen durch visuelle Dokumentation
Leistungsbeurteilungen sind ein zentraler Bestandteil des Talentmanagements. Sie bieten eine Gelegenheit, die Fortschritte, die Leistungen und die Bereiche für Verbesserungen bei jedem Mitarbeiter zu evaluieren. Durch die Integration der Digitalfotografie in diesen Prozess können HR-Teams eine visuelle Chronik der Mitarbeiterleistung erstellen. Fotos können dabei helfen, besondere Momente, Projekterfolge oder auch Herausforderungen festzuhalten und zu illustrieren. Diese visuelle Dokumentation kann eine objektivere und ganzheitlichere Sicht auf die Leistung des Mitarbeiters bieten und eine konstruktive Diskussion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern fördern.
Durch die Aufnahme von Fotos in Mitarbeiterbewertungen können auch bestimmte Situationen oder Ereignisse besser kontextualisiert werden, was zu faireren und genaueren Bewertungen führen kann. Darüber hinaus können diese visuellen Aufzeichnungen auch zur Selbstbewertung und Reflexion durch die Mitarbeiter genutzt werden, was letztendlich zur persönlichen und beruflichen Entwicklung beiträgt.
Rahmen der Organisationskultur: Die Auswirkung der Fotografie auf die Arbeitgebermarke
Die Arbeitgebermarke ist das Fenster durch das potenzielle Talente in die Organisationskultur blicken können. Eine starke Arbeitgebermarke kann Talente anziehen und binden. In diesem Zusammenhang kann die Digitalfotografie eine wertvolle Ressource sein, um die einzigartigen Aspekte der Unternehmenskultur visuell darzustellen. Professionelle Fotos können die Arbeitsumgebung, Teamdynamik und Unternehmensveranstaltungen authentisch präsentieren und so ein klares Bild der Organisationskultur vermitteln.
MPB verfügt über eine Reihe von Kameras, die sich hervorragend für die Aufnahme hochwertiger Bilder eignen, die die Essenz Ihrer Unternehmenskultur einfangen können. Diese Bilder können auf der Unternehmenswebsite, in sozialen Medien oder in Rekrutierungsmaterialien verwendet werden, um ein attraktives und authentisches Bild des Unternehmens zu präsentieren.
Die Visualisierung der Organisationskultur durch Fotografie kann auch die interne Bindung und das Engagement fördern, indem sie den Stolz und die Zugehörigkeit zur Organisation stärkt. Darüber hinaus können Fotos von Unternehmensveranstaltungen oder Teamprojekten eine gemeinsame Erfahrung dokumentieren und teilen, was die Zusammengehörigkeit und die Teammoral fördert.
Erfolg visualisieren: Wie die Digitalfotografie bei der Festlegung und Erreichung von HR-Zielen hilft
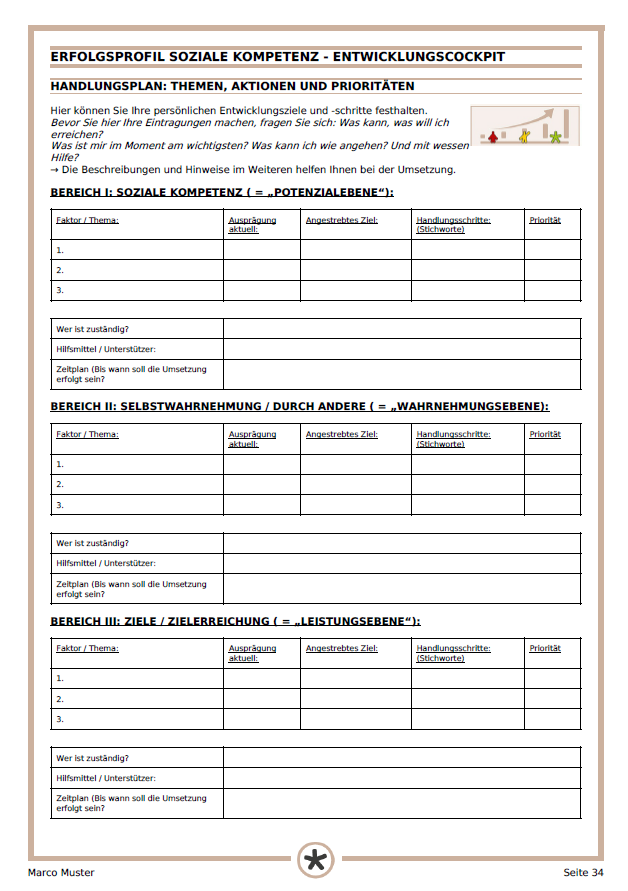
Das Setzen und Verfolgen von Zielen ist ein wesentlicher Bestandteil des HR-Managements. Mit der Digitalfotografie können HR-Teams den Fortschritt in Richtung Unternehmensziele visuell dokumentieren und präsentieren. Durch die Erstellung von visuellen Berichten über Projekte, Teamleistungen oder individuelle Erfolge können sowohl die Teams als auch die Unternehmensleitung den Fortschritt leichter nachvollziehen und feiern.
Fotos können auch genutzt werden, um wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Erreichung der Unternehmensziele festzuhalten. Dies schafft nicht nur eine visuelle Chronik des Erfolgs, sondern fördert auch die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter durch die Anerkennung ihrer Beiträge zum Gesamterfolg des Unternehmens.
Darüber hinaus können visualisierte Erfolge in den sozialen Medien oder auf der Unternehmenswebsite geteilt werden, um die externe Wahrnehmung des Unternehmens positiv zu beeinflussen und eine Kultur des Erfolgs und der Anerkennung zu fördern.
Fokus auf Lernen und Entwicklung: Fortschritte durch Fotografie festhalten
Lernen und Entwicklung sind Kernaspekte der Personalentwicklung. Durch die Digitalfotografie können HR-Teams den Fortschritt der Mitarbeiter in Schulungsprogrammen oder bei der Erreichung von Entwicklungszielen dokumentieren. Fotos von Schulungssitzungen, Workshops oder Teamprojekten können helfen, den Lernprozess zu illustrieren und die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen zu zeigen.
Die fotografische Dokumentation von Lern- und Entwicklungsinitiativen kann auch zur Weiterentwicklung von Programmen und Strategien genutzt werden, indem sie Rückmeldungen und Einsichten in die Wirksamkeit von Schulungsansätzen liefert. Diese visuellen Aufzeichnungen können auch den Mitarbeitern helfen, ihre eigene Entwicklung zu sehen und zu schätzen, was wiederum die Motivation zur Weiterentwicklung fördert.
Außerdem können durch Fotografie festgehaltene Erfolgsgeschichten und Fallstudien als inspirierende Beispiele für andere Mitarbeiter dienen und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung fördern.


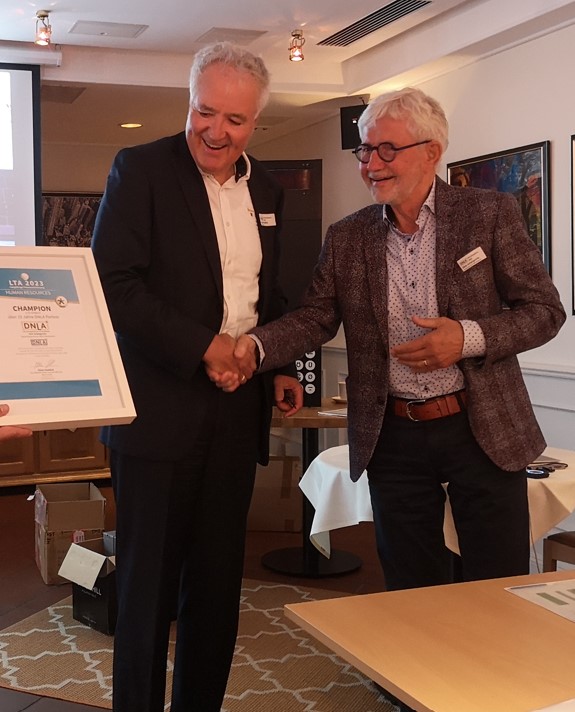
Bücher, die man kennen sollte – Führung und Transformation für eine veränderte Welt
Wer beruflich Erfolg haben will, muss heutzutage nicht zwangsläufig ein umfangreiches Wissen mitbringen. Die Zeiten, in denen erworbene Qualifikationen für Jahrzehnte unveränderter Tätigkeit ausreichten sind vorbei. Mitarbeitende und Führungskräfte heute brauchen eher die Bereitschaft, ständig dazu zu lernen, Neues aufzunehmen und auch vermitteln zu können. Nur so gelingt eine Neuausrichtung vom Alten zum Innovativen, und zwar ohne Angst, Stress und Unsicherheiten. Ratgeber dazu gibt es wie Sand am Meer – doch welche von ihnen taugen wirklich? Wir stellen Ihnen Bücher zu Management und Führung, die man kennen sollte, vor:
Unternehmensführung und Management, Transformation
Detlef Lohmann: …und mittags geh ich heim: Die völlig andere Art, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen
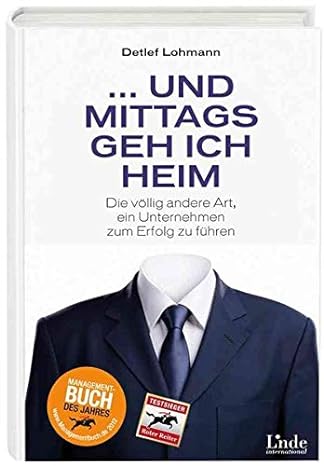
Führen ohne Anwesenheitspflicht. Alles, was man an der Universität über Wirtschaft lernt all das macht Detlef Lohmann nicht. Hierarchien? Abteilungen? Chefs, die Entscheidungen treffen? Damit hat der Unternehmenschef gehörig aufgeräumt und hat die klassische Pyramide der Organisation auf den Kopf gestellt. Nach den Maßstäben der BWL kann dieses Unternehmen gar nicht existieren. Doch die Realität beweist das Gegenteil: Der Laden läuft nicht nur, er ist auch extrem erfolgreich, flexibel, robust. Lohmann hat herausgefunden: Wenn man die richtigen Strukturen schafft und die Mitarbeiter dann einfach machen lässt, müssen Führungskräfte nichts mehr tun. Sie haben jede Menge Zeit für das, was Führung eigentlich sein sollte. Und mittags? Gehen sie einfach heim … …ein Buch über ein agiles Unternehmen, aus einer Zeit, als man das so vielleicht noch gar nicht nannte.
Die stille Revolution: Führen mit Sinn und Menschlichkeit
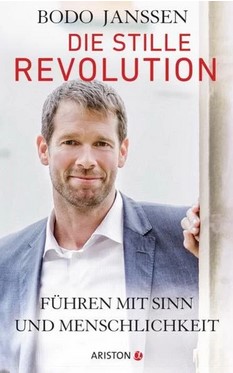
Führung ist Dienstleistung und kein Privileg
Ein erfolgreicher Mensch ist nicht unbedingt glücklich, aber ein glücklicher Mensch ist erfolgreich. Eine Lebensweisheit, die Bodo Janssen auf die harte Tour gelernt hat: Als Student wurde er entführt – eine Grenzerfahrung, die den Unternehmersohn auf seine schiere Existenz zurückgeworfen hat. Als er später ins elterliche Unternehmen einstieg, ergab eine Mitarbeiterbefragung niederschmetternde Ergebnisse: ein anderer Chef sollte her. Bodo Janssen begann umzudenken, radikal. Und er entwickelte völlig neue Formen der Unternehmensführung – Grundsätze, die genug Sprengstoff in sich tragen, um unser Verhältnis zueinander in der gesamten Gesellschaft zu verändern. Einer seiner Glaubenssätze: »Wenn jemand als Führungskraft etwas verändern möchte, ist er gut damit beraten, zunächst und ausschließlich bei sich selbst anzufangen.«
Bodo Janssen: Die stille Revolution: Führen mit Sinn und Menschlichkeit
Reinhard K. Sprenger: Radikal führen
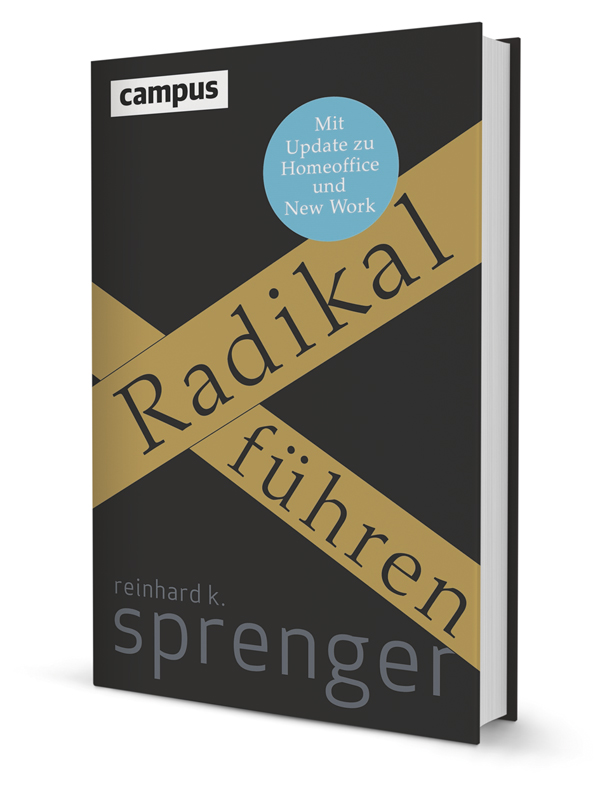
Kenner der Management-Literatur schätzen den Verfasser und sein Buch bereits seit einem Jahrzehnt. Denn Sprenger bringt mit seiner radikalen Annäherung wichtige Fragen rund ums Management auf den (wunden) Punkt. Er will Führungskräfte wegholen vom Mikromanagement und ihnen aufzeigen, wie sie es schaffen, sich auf die wirklichen Kernaufgaben zu konzentrieren. Dazu beschreibt der Autor aktuelle und branchenübergreifend anwendbare Fälle, Tasks und Probleme, die Leser und Leserinnen tatsächlich in die Praxis umsetzen können, sei es bei der Administration, bei der Problemlösung oder bei der Entwicklung von Strategien.
Reinhard K. Sprenger – Radikal führen – ein Standardwerk über Führung, aktualisiert und ergänzt um Homeoffice und New Work.
Oliver Haas u.a.: Transformation
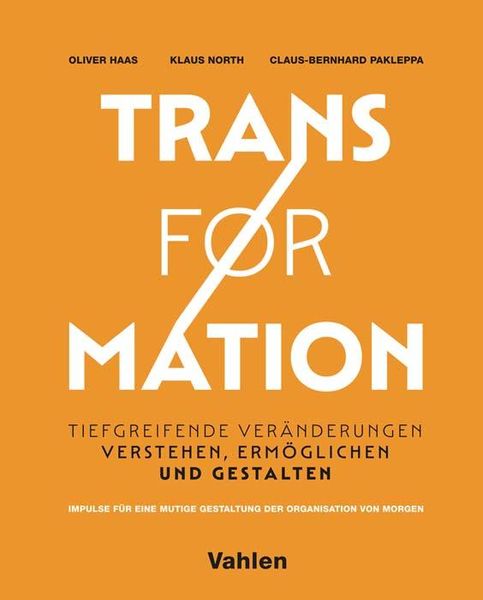
Transformation, noch vor wenigen Jahren eine Neuigkeit, wird angesichts aktueller Herausforderungen zur Normalität. Mit Transformation müssen sich alle Ebenen der Gesellschaft auseinandersetzen. Sie zu begreifen, zu strukturieren und andere Menschen durch die Transformation zu führen ist inzwischen eine Kernkompetenz, ohne die Führungskräfte in Politik und Wirtschaft nicht mehr auskommen. Dass es dafür kein Patentrezept gibt, stellen die Autoren klar heraus, und ebenso, dass Transformation ein laufender Prozess ist – und ein Mindset.
Oliver Haas, Klaus North, Claus-Bernhard Pakleppa: Transformation – Tiefgreifende Veränderungen verstehen, ermöglichen und gestalten
Anja Förster: Vergeude keine Krise!
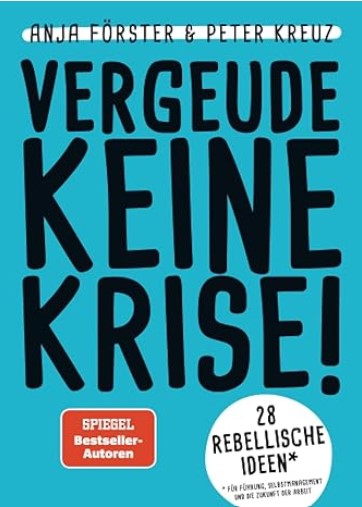
Krisen als Chance, jedenfalls nach dieser Autorin – denn jede Krise rüttelt auch auf und zwingt alle Betroffenen, Selbst- und Weltbilder in Frage zu stellen. Wo sowieso das Unterste zuoberst gekehrt wird, lohnt es sich, es auf Verwendbarkeit abzuklopfen, anstatt einfach nur weiterzumachen wie bisher!
Psychologie und Soft Skills
Daniel Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken
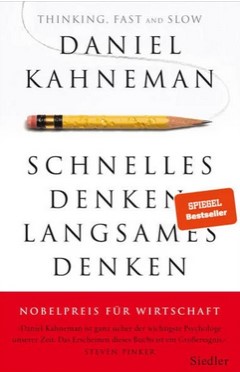
Vom Nobelpreisträger Kahneman stammt eine lesenswerte Abhandlung über das Denken und seine Facetten. Kahnemann illustriert die Abläufe im Gehirn, die Entscheidungsfindung und was sie beeinflusst. Der Leser lernt, dass der vermeintliche „Sapiens“ längst nicht so rational denkt und agiert, wie er das selbst gerne hätte. Ein Buch, das mit vielen, teils geliebten Vorstellungen aufräumt und erstaunliche Einblicke in mentale Strukturen bietet – unbedingt lesenswert.
Daniel Kahneman: Schnelles Denken, langsames Denken
Andreas Patrzek, Stefan Scholer: Die Kraft des Fragens
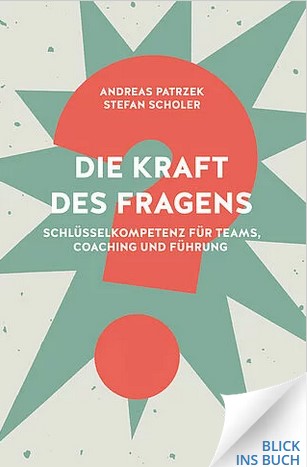
Eine neue Gesprächskultur wünschen sich die Verfasser und betrachten vermeintliche Gespräche allzu oft als Monologe, bei denen kein wirklicher Austausch stattfindet. Veränderungen und Einsichten anstoßen können nur Fragen – und die Formulierung von Fragen will gelernt sein. Das fesselnde Thema wird mit Beispielen vermittelt, die Leser und Leserinnen unmittelbar ansprechen. Ohne einen erhobenen Zeigefinger gelingt die Vermittlung von Gesprächs- und Fragekultur mit einem echten Dialog.
Annette Dernick: Der Peace-Faktor – endlich Frieden im Büro
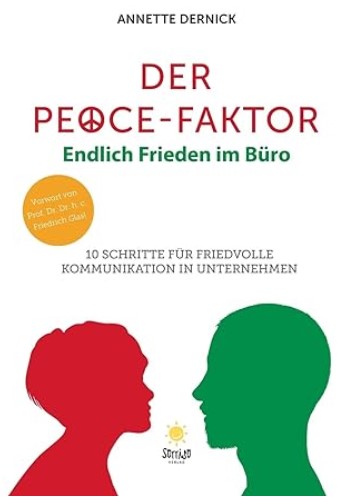
10 Schritte für friedvolle Kommunikation im Unternehmen. Erleben Sie jetzt, was den PEACE-Faktor in Ihrer Kommunikation und in Ihrem Unternehmen ausmacht- wie Sie den Respekt am Arbeitsplatz bekommen, den Sie sich wünschen- und wie Sie mit einfachen Mitteln zu mehr ZuFRIEDENheit im Job gelangen.
Annette Dernick: Der Peace-Faktor – endlich Frieden im Büro
Zeitmanagement
Lucius Annaeus Seneca: De Brevitate Vitae (Von der Kürze des Lebens)
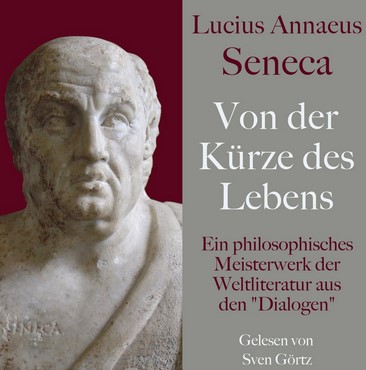
Der römische Philosoph Seneca, unter anderem Tutor des Kaisers Nero, gilt als führender Vertreter der römischen Stoa. Die Gelassenheit im Umgang mit den Höhen und Tiefen des Lebens bezieht der Stoiker aus einer abgeklärten Distanz. Zu den erfolgreichsten, zeitlosen Schriften Senecas gehört die Abhandlung über die Kürze des Lebens. Hier geht es um Zeitmanagement – denn wie Seneca feststellt, ist das Leben nie zu kurz, aber leider oft in hohem Maß verschwendet. Anschaulich und nachvollziehbar sind die Gedankengänge des Römers bis heute. Seneca war nicht nur ein zu Lebzeiten erfolgreicher Autor, sondern außerdem ein schwer reicher Geschäftsmann und kluger Investor.
Lucius Annaeus Seneca – De Brevitate Vitae (Von der Kürze des Lebens)
Ivan Blatter: Arbeite klüger, nicht härter
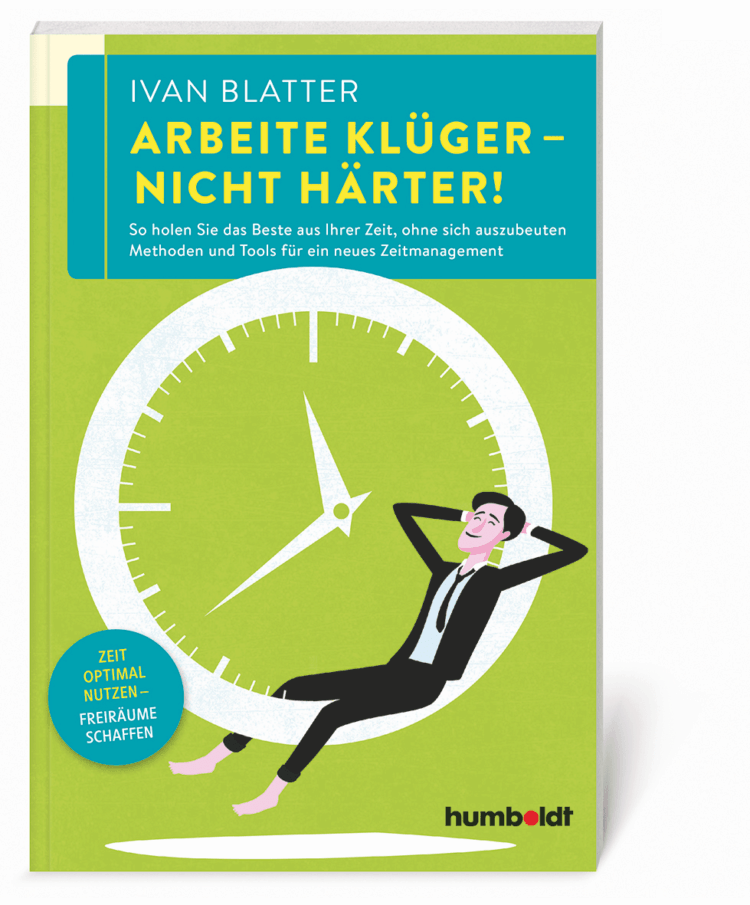
Schöne neue Arbeitswelt: In Zeiten schneller Informationen, neuer Technologien und Digitalisierung funktionieren viele traditionelle Methoden des Zeitmanagements nicht mehr. Mit der Erreichbarkeit rund um die Uhr verschwimmt die Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben.
Doch der Tag hat nur 24 Stunden – und wir brauchen neue Strategien, diese optimal zu nutzen und Freiräume zu schaffen.
Ivan Blatters Ratgeber „Arbeite klüger – nicht härter“ weitet den Blick auf das Zeitmanagement. Er gibt sofort umsetzbare Tipps, Tools und Methoden, die helfen, sich mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu schaffen. Denn ein gutes Zeitmanagement findet primär im eigenen Kopf statt!
Ivan Blatter – Arbeite klüger, nicht härter
David Allen: Wie ich Dinge geregelt kriege: Selbstmanagement für den Alltag. Zum Erfolg mit der Getting Things Done Methode (GTD) – das Original!
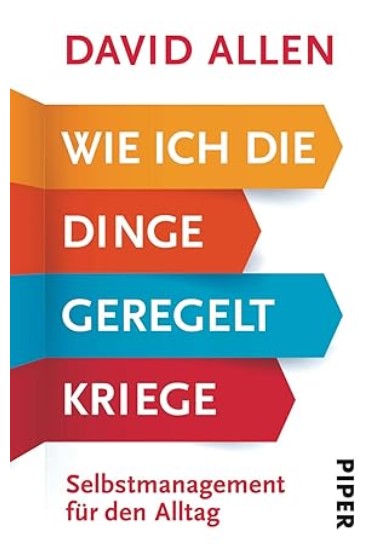
Ein künftiges Standardwerk, ergänzt um ein gleichnamiges Workbook – eignet sich gut für alle, die es ernst meinen mit der künftigen verbesserten Effektivität. Das beste an Allens „Getting Things Done“ Methode ist, dass sie vollkommen nachvollziehbar und umsetzbar ist. Ab der ersten Seite können Leser an sich arbeiten – mit messbaren Erfolgen.
David Allen – Wie ich Dinge geregelt kriege
Ein Buch führt zum nächsten…
Leser begeben sich auf eine innere Entdeckungsreise – vor allem, wenn sie sich auf wertvolle Bücher einlassen. Die hier vorgestellten Titel sind Beispiele dafür, wie Denkanstöße gelingen. Die Ergebnisse, die man aus der Lektüre dieser Bücher mitnimmt, wirken nach, noch lange Zeit, nachdem die letzte Seite umgeschlagen wurde. Oft macht das Appetit auf weitere, ähnliche Bücher und stößt so einen wirklichen Entwicklungsprozess an. Die besten Bücher zum Thema Transformation, Führung und Psychologie dürfen gern weiter empfohlen werden. Sie eignen sich als Geschenke, zum Weiterreichen oder für die Erwähnung in eigenen Präsentationen oder eigene wissenschaftlichen Arbeiten wie Diplom, Master oder Dissertation zu verwandten Themen. Und vielleicht wird aus dem einen oder anderen Leser schließlich ein Autor, der seinerseits wichtige Beiträge und Denkanstöße für die Unternehmens- und Führungskultur der Zukunft liefert. Und bei der Umsetzung Ihrer Buchidee, bei Lektorat, Korrektorat, Transkription und Textformulierung, helfen Dienstleister wie https://wirschreiben.ch/
Buchempfehlung: Bücher unserer DNLA-Partner
Im Kreis der DNLA-Berater*innen gibt es schon einige, die bereits selbst Autor*innen sind und die Bücher zu Management-Themen verfasst haben. Viele dieser Bücher finden Sie bereits auf unserer Webseite, im Bereich Buchveröffentlichungen und wissenschaftliche Arbeiten. Weitere haben wir hier für Sie zusammengetragen*:
(*Sie sind DNLA Berater*in und Ihr Buch taucht hier noch nicht auf? Das lässt sich ändern! Melden Sie sich gerne bei uns, dann nehmen wir auch ihr Werk in die folgende Liste auf. Bei fast 400 Kolleginnen und Kollegen haben wir leider nicht auf Anhieb im Blick, wer alles schon ein Buch zu einem spannenden Management-Thema veröffentlicht hat).
Bernd Ahrendt / Ulrich Heuke / Wolfgang Neumann / Frank Tubbesing: Erfolgsfaktor Sozialkompetenz – Mitarbeiterpotenziale systematisch identifizieren und entwickeln
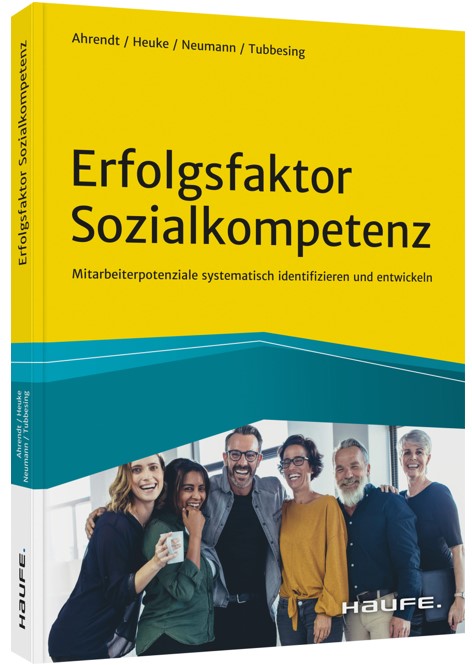
Mitarbeiter und ihre Kompetenzen werden immer wichtiger für Unternehmen und können sogar einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Daher ist es wichtig, ein Kompetenzmanagement zu etablieren, das ein systematisches Vorgehen gewährleistet. Doch die Identifizierung und Kontrolle der persönlichen und sozialen Kompetenzen stellt die Verantwortlichen im Vergleich zur fachlichen Kompetenz vor eine große Herausforderung, da es über die bewusste Abfrage von Wissen hinausgeht. Das Controlling sozialer Kompetenzen wird so zum Engpassfaktor eines Kompetenzmanagements.
Mit einem fundierten Theorieteil und mit Praxiskapiteln mit anschaulichen Best-Practice-Beispielen zum Kompetenzmanagement in ganz unterschiedlichen Unternehmen – von BMW bis zur Caritas, vom Mittelständler bis zur Landeshauptstadt München – zeigt das Buch, wie Kompetenzmanagement und Kompetenzentwicklung gelingen können.
Bernd Ahrendt / Ulrich Heuke / Wolfgang Neumann / Frank Tubbesing: Erfolgsfaktor Sozialkompetenz – Mitarbeiterpotenziale systematisch identifizieren und entwickeln
Joachim Studt (mit Mitarbeit von Andreas Heuberger): Change Management – Neue Berufswege erschließen, planen und gestalten.
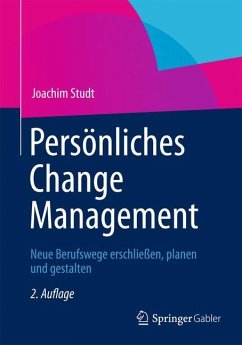
Äußere Umstände wie akuter Stellenabbau, aber auch wachsende persönliche Unzufriedenheit erfordern häufiger denn je auch bei gestandenen Arbeitnehmern im mittleren Alter den Umstieg auf einen alternativen beruflichen Lebensplan. Joachim Studt macht Mut, sich auf diese große Herausforderung einzulassen, sich nachhaltig neu zu orientieren sowie den Wechsel und den neuen Berufs- und Lebensweg selbst zu gestalten.Viele Praxisbeispiele, Handlungsanweisungen und Reflexionsübungen erschließen die Kompetenzen und Potenziale des Lesers, um einen tragfähigen persönlichen Neuansatz zu entwickeln. Zu den äußeren Erfolgsfaktoren gehört dabei gutes Networking.
Heike Höf‑Bausenwein: Crashkurs Personalarbeit
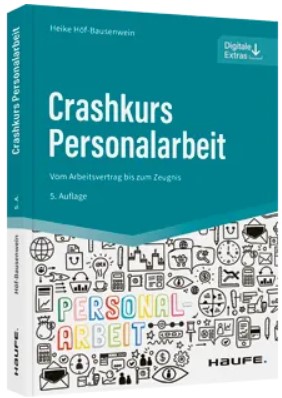
Personalarbeit ist heute viel mehr als nur die Verwaltung von Mitarbeiterunterlagen und die Entgeltabrechnung. Dieses Buch bietet einen kompakten Rundumblick in das Human Resources Management und hilft, sich schnell ins Thema einzuarbeiten. Sie erhalten das komplette Handwerkszeug für die täglichen Personalaufgaben. Analog des Werdegangs eines Beschäftigten im Unternehmen erfahren Sie alles über Personalbeschaffung und -betreuung, Personalentwicklung sowie arbeitsrechtliche Themen der Freisetzung. So sind Sie vom ersten Tag an immer auf der sicheren Seite.
Neu in der 5. Auflage: digitale Krankmeldung, Betriebsrätemodernisierungsgesetz, Homeoffice und mobile Arbeit sowie die E-Signatur.
Heike Höf‑Bausenwein: Crashkurs Personalarbeit
Heike Höf-Bausenwein: Arbeitswelten transformieren – Der Wegweiser für Entscheider – Wandel aktiv gestalten
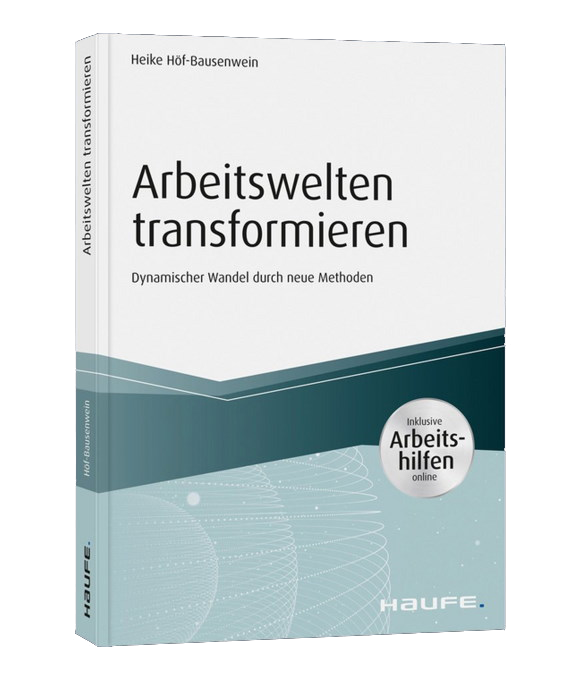
Ein Buch für Entscheider, Geschäftsführer/-in und Personalverantwortliche. Wie gestalte ich den Wandel der Arbeitswelt 4.0? Hierunter fallen Themen, wie z.B. Homeoffice, mobile Arbeit oder wie setze ich die Digitalisierung um? Das Buch verschafft Ihnen einen Überblick über die Transformation der Arbeitswelt 4.0 und gibt Ihnen zeitgemäße Strukturen, Methoden sowie Kompetenzen an die Hand.
Eine ausführliche Darstellung der Methode „Faszination Metamorphose“ dient zur Umsetzung der o.g. Punkte. Sorgen Sie für zufriedene und gesunde Mitarbeiter und minimieren Sie Fehlzeiten der Angestellten.
Heike Höf-Bausenwein: Arbeitswelten transformieren – Der Wegweiser für Entscheider – Wandel aktiv gestalten
Selbstführung für Anfänger – ein Weg zu mehr Zufriedenheit und Erfolg im (Berufs-)leben – ein Praxisleitfaden
Hier wird verständlich erklärt, was das Konzept der Selbstführung wirklich im Kern bedeutet, warum jede und jeder von uns davon nur profitieren kann, und wie man Selbstführung erlernen und trainieren und Schritt für Schritt in der Praxis umsetzen kann.
Selbstführung hilft uns, im Beruf endlich glücklicher, freier und erfolgreicher das eigene „Koordinatensystem“ zu finden. Sie hilft uns, unser Handeln im beruflichen Alltag zu steuern und den eigenen Weg zu gehen. Wir lernen, zu erkennen, was uns selbst bei der Arbeit (und im privaten Bereich) wichtig ist, und wie wir diese Dinge am besten in Einklang bringen mit den Anforderungen unseres Berufs, unserer Arbeitsumgebung oder unseres Arbeitgebers. Selbstführung ist also „unser innerer Kompass auf dem Weg in die Zukunft“ – doch was genau bedeutet das? Und kann das jeder einfach so? Wie kann man Selbstführung erlernen und was hilft einem dabei?
Diesen Fragen gehen wir hier auf den Grund.
Unzufriedenheit im Beruf und Suche nach Orientierung und nach Wegen aus der beruflichen Sackgasse – Ist Selbstführung der Schlüssel zur Lösung?
Wir haben immer mehr Möglichkeiten: Unzählige Ausbildungen und Studiengänge stehen uns heute offen, ein globaler Arbeitsmarkt, Möglichkeiten, sich selbständig zu machen. Hinzu kommen neue Arbeitsformen (Stichwort „New Work“, Home Office, 4-Tage Woche) – in der schönen neuen (Arbeits-)Welt gibt es unzählige Wege, die uns offen stehen.
Andererseits hören wir bei unseren Kundenterminen und Coachings oft „ich bin mit meiner beruflichen Situation unzufrieden“, „mein jetziger Job / mein Arbeitgeber bietet mir keine geeigneten Perspektiven“ und „ich suche Orientierung“.

Symbolbild: Suche nach Orientierung, nach den richtigen Koordinaten für das eigene (Berufs-)leben.
Unendliche Möglichkeiten einerseits – zahlreiche Menschen, die sich beruflich in der Sackgasse fühlen andererseits. Wie passt das zusammen? Offensichtlich können viele Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen nicht die Arbeitsumgebung und die Inhalte und Perspektiven bieten, die diese sich wünschen und die sie brauchen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.
Bietet hier das Konzept der „Selbstführung“ eine Antwort? Müssen die Mitarbeitenden heute ihren eigenen Weg zum beruflichen Glück, zum „Traumjob“ finden? In den folgenden Abschnitten erklären wir das Konzept der „Selbstführung“ und geben einfache und konkrete Tipps zur praktischen Umsetzung.
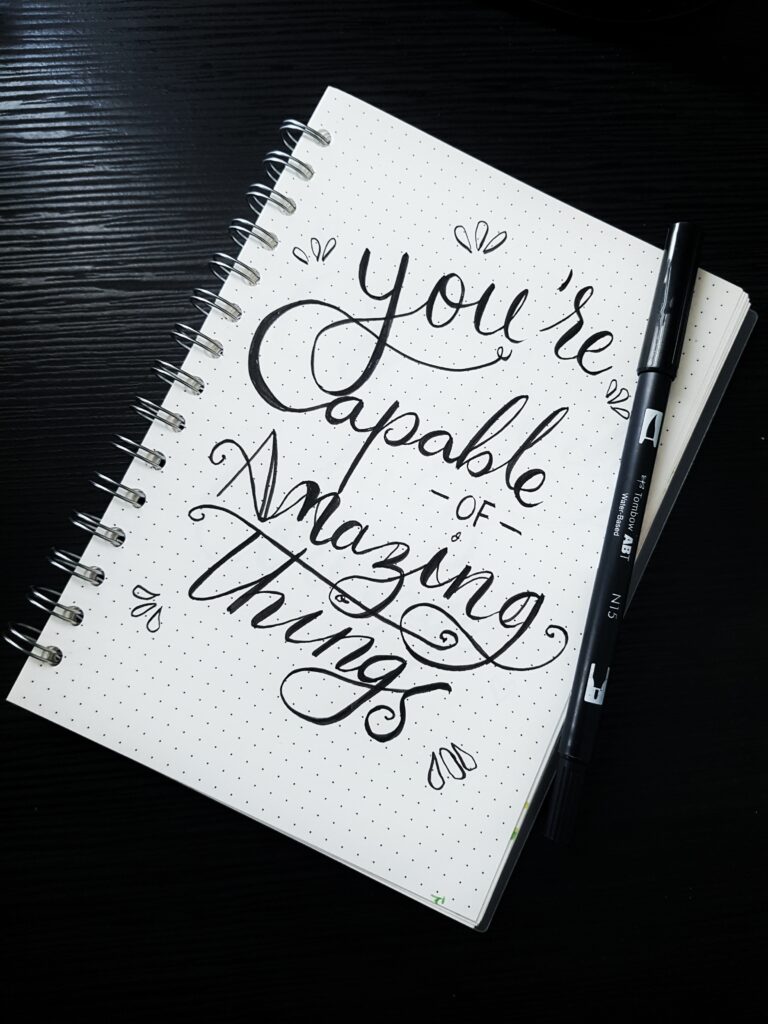
„You are capable of amazing things – Du bist zu erstaunlichen Dingen fähig“: In jeder / jedem von uns steckt unendlich viel an Potenzialen. Wenn wir sie erkennen und eine Arbeitsumgebung oder Richtung für uns finden, in der wir sie optimal nutzen können, dann dürfen großartige Dinge entstehen.
Selbstführung – was ist das überhaupt?
Wenn wir von Selbstführung sprechen, müssen wir zunächst einmal klären, was Selbstführung ist – und was nicht.
- Oftmals wird der Begriff der Selbstführung mit Zeitmanagement assoziiert. Zeitmanagement ist natürlich ein Aspekt – aber Selbstführung ist mehr und nicht einfach nur ein Synonym für „Zeitmanagement“, „Effizienz“ und Selbstorganisation.
- Auch „Selbstreflexion“ und Selbstregulierung oder Selbststeuerung werden oft genannt, wenn es um Selbstführung geht. Das trifft den Kern der Sache schon wesentlich besser, reicht aber an sich immer noch nicht aus.
- Wir verstehen unter „Selbstführung“ oder „Selbstmanagement“ die Kompetenz, die berufliche und persönliche Entwicklung selbständig und weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten, um die eigene Motivation zu erhöhen, eigene Ziele zu klären und diese besser zu erreichen. Erfolgreiche Selbstführung erhöht die eigene Selbstwirksamkeit und die Umsetzungskompetenz. Sie versetzt uns in die Lage, die eigenen Ressourcen zu kennen, diese zu aktivieren und gezielt für unsere Ziele und das, was uns im (Berufs-)leben wichtig ist, einzusetzen.
Selbstführung für Anfänger – kann jede*r Selbstführung erlernen, und wenn ja, wie geht das?
„Die persönliche und berufliche Entwicklung selbständig gestalten“, dadurch die Motivation und die Selbstwirksamkeit erhöhen – mal ehrlich: Klingt toll, aber auch ganz schön kompliziert. Beziehungsweise ganz schön ungenau. Wie soll das denn nun konkret gehen? Kann ich als Laie das einfach anpacken? Oder brauche ich dazu wieder einen teuren Coach oder andere Helfer, die mich anleiten und „führen“, damit ich das mit der Selbstführung dann (hoffentlich…) irgendwann hinbekomme? Was ja dann nicht im Sinne der Sache wäre… .
So oder ähnlich denken vermutlich die meisten, die das hier lesen. Und das ist auch ganz vernünftig.
Schauen wir uns also an, wie das mit der Umsetzung klappen kann: Selbstführung ist ein Prozess, der einen kontinuierlich durchs Berufsleben begleitet, und nicht etwas, das man einmal kurz und zwischendurch praktizieren muss. Das folgende Schaubild zeigt, in welchen Phasen und Schritten Selbstführung abläuft:
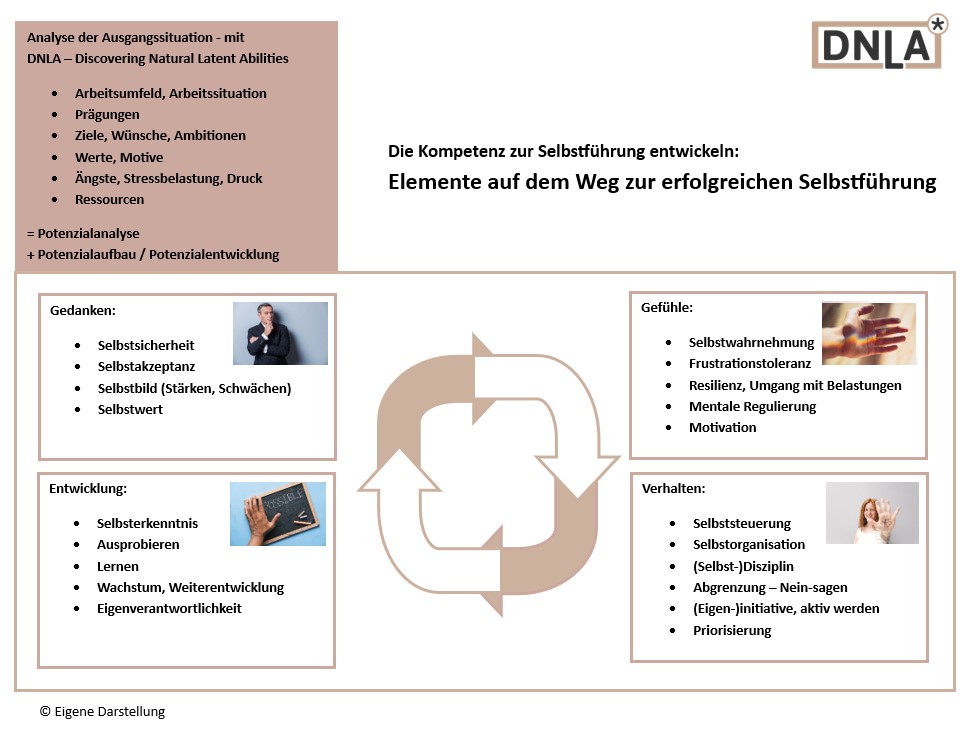
Im Folgenden erläutern wir einige Details zu dieser Übersicht.
Selbstführung lernen, in drei Schritten:
1. Die Analyse: Prägungen und Potenziale ermitteln
Bevor man „loslegt“, ist es wichtig, sich erst einmal selbst ein genaues Bild der Situation zu machen und sich klar zu werden, was einen derzeit und aus der Vergangenheit her prägt und steuert und auch, was man sich erwartet, wo die Reise hingehen soll, sozusagen.
Um die eigenen Prägungen, das was einen an- und umtreibt kennen zu lernen und genauer zu analysieren und zu reflektieren, bieten sich wissenschaftlich fundierte Potenzialanalysen an. Eine Analyse, die die Potenziale im beruflichen Bereich in ihrer derzeitigen Ausprägung sehr schön aufzeigen kann, und die gerade auch im Umfeld der beruflichen Orientierung, der persönlichen Entwicklung und des Talent Managements* stattfindet, ist DNLA – Discovering Natural Latent Abilities.
(*Kurze Factsheets dazu siehe unten am Ende des Artikels).
Mit Hilfe von DNLA lässt sich hervorragend analysieren, wo jemand im Moment steht, wo es starke Ausprägungen gibt, und wo mögliche Handlungsfelder.
Betrachten wir das einmal kurz an einem Beispiel-Profil:
- Es zeigt überdurchschnittlich gute Werte beispielsweise in „Kritikstabilität“ und „Misserfolgstoleranz“,
- aber geringe Ausprägungen in „Selbstvertrauen“ und in „Initiative“.
- Damit einhergehend: Eine geringe Ausprägung im Indikator für „Führungswille“.
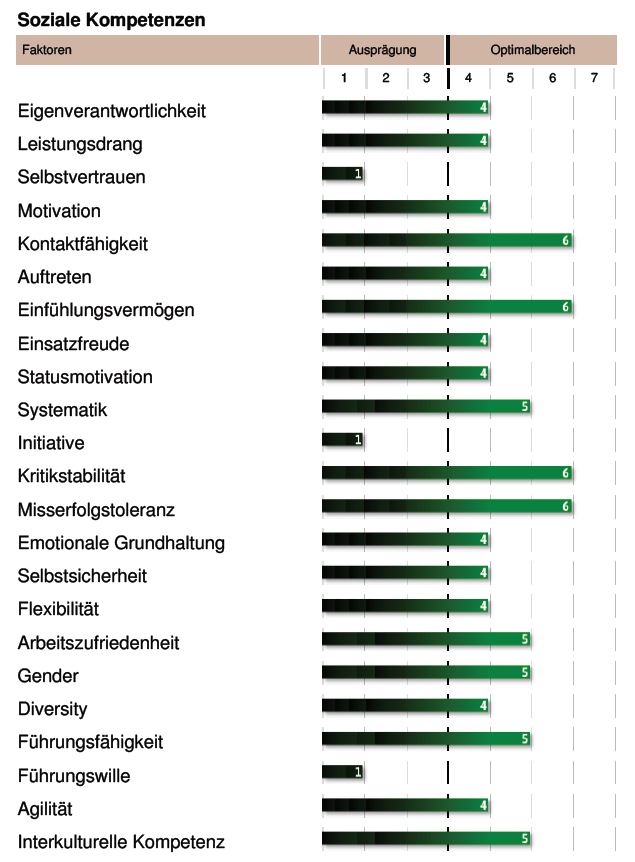
2. Im Feedbackgespräch: Hinterfragen und reflektieren
Die Analysedaten sind aber nur der Ausgangspunkt. Diese Ergebnisse der DNLA-Analyse sind Grundlage für ein persönliches Feedbackgespräch. Hier wird, unter Berücksichtigung der beruflichen Biographie, der aktuellen Situation und der Motive und persönlichen Ziele, die sich auf die Zukunft beziehen, bei der Teilnehmerin / dem Teilnehmer hinterfragt, welche Einflussfaktoren für die geringer ausgeprägten Potenziale (hier in den Faktoren „Selbstvertrauen“ und „Initiative“) mit verantwortlich sind.
Das Feedbackgespräch berührt Punkte wie die aktuelle Arbeitssituation, derzeitige Herausforderungen und besondere Belastungen sowie die Zukunftsperspektiven und die persönlichen Wünsche genauso wie das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung (und damit einhergehend: Selbstsicherheit, Selbstwert und Selbstakzeptanz), Gefühle und emotionale Reaktionsmuster in bestimmten Arbeitssituationen (z.B. beim Umgang mit Kritik oder mit Misserfolgen) und natürlich Verhaltensweisen und Handlungsmuster.
(Vgl. Schaubild oben „Elemente auf dem Weg zur erfolgreichen Selbstführung“).
3. Im Anschluss an das Feedbackgespräch: Konkrete Handlungsempfehlungen mit in den Alltag nehmen, um Selbstführung zu erlernen und zu praktizieren
Sich dieser Prägungen und Muster bewusst zu werden und sie zu erkennen ist als erster Schritt bereits sehr wertvoll: Je genauer man weiß, wo man steht, wo man noch seine „Baustellen“ oder Herausforderungen hat und wo man sich noch weiterentwickeln kann, desto besser kann man an den richtigen Stellen ansetzen. Damit ist schon viel erreicht. Der nächste wichtige Schritt nach der Analyse und der Reflexion ist die Entwicklung.
Zur weiteren Umsetzung und zur Arbeit an den eigenen Kompetenzen und Potenzialen hat man möglicherweise „Sparringspartner“ an der Hand, in Person von unternehmensinternen Mentor*innen oder Personalentwickler*innen, durch geschulte DNLA-Berater*innen und durch Menschen, die einen im privaten Umfeld begleiten und die einem helfen, die eigenen Potenziale weiter zu entwickeln und beruflich voranzukommen in Richtung der eigenen Ziele.
Um diese Entwicklung jedoch auch selbst konsequent vorantreiben zu können, ist es wichtig, die eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster zu reflektieren und auf dieser Basis das eigene Verhalten in Richtung der eigene Ziele zu steuern.

Fragen, die dabei helfen können, die Selbstführung zu erlernen und umzusetzen, sind beispielsweise:
1. Die jetzige Situation, die eigenen Werte und die eigenen Ziele betreffend
- Was mache ich hier und warum tue ich das?
Das ist die schwierigste und vielleicht wichtigste Frage gleich vorweg – die nach dem Sinn. Wenn sie sich nicht wirklich gut beantworten lässt, dann schließt die nächste Frage an: Was möchte ich stattdessen tun und warum? Verwandt ist damit auch die nächste Frage: - Was möchte ich verändern/verbessern?
Denn es muss ja nicht immer gleich der komplette Job / die komplette Arbeitssituation sein, die man ändern möchte. Vielleicht ist es nur der derzeitige Aufgabenzuschnitt, bestimmte Arbeitsabläufe oder die Arbeitsaufteilung, die nicht passen? Oder man möchte gerne ein anderes, besseres Verhältnis zu bestimmten Kollegen oder Vorgesetzten? Auch Arbeitsumstände und Arbeitsformen (Teilzeit, hybrid, remote, familienfreundlicher, …) können eine wichtige Rolle spielen. - Was ist mir wichtig bei der Arbeit? Was treibt mich an?
Auch die Klärung dieser Frage hilft, zu erkennen, warum bestimmte Dinge an der aktuellen Arbeitssituation für einen unbefriedigend sind und was einem derzeit noch „fehlt“. Punkte wie „mich weiterentwickeln, dazulernen“, „einen angemessen hohen materiellen Gegenwert für meine Arbeit erreichen“, „andere unterstützen“, „etwas tun, in dem ich einen Sinn sehe“ oder auch ´einfach` ´nur` „endlich Anerkennung bekommen für das, was ich tue und in einem positiven und wertschätzenden Umfeld arbeiten“ können hier für den Einzelnen relevant sein. - Wo will ich hin?
Wie soll meine berufliche (und damit verbunden häufig auch: private) Zukunft idealerweise aussehen?
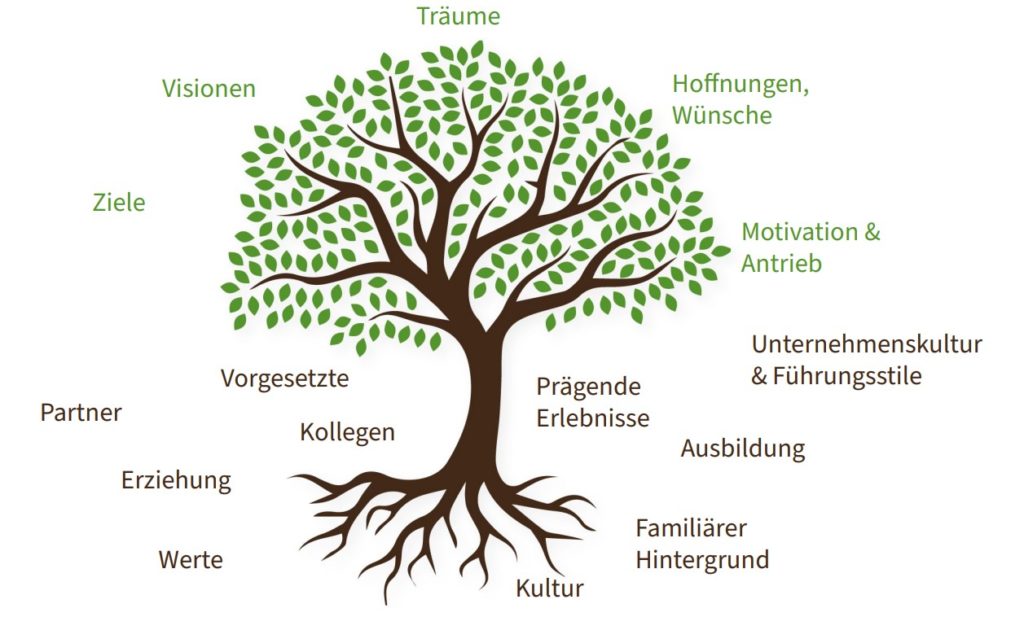
Wo liegen meine Wurzeln? Was beeinflusst mich derzeit, und wo will ich hin?
2. Den bisherigen Weg und die Zukunft betreffend:
- Was habe ich bisher (im beruflichen Bereich) erreicht? Auf welche Dinge in meinem (Berufs-)leben bin ich wirklich stolz?
Diese Frage hilft einem ebenfalls noch einmal, zu merken, was einem wirklich wichtig ist, und wann / wodurch man sich wirklich wohl fühlt. - Was hindert mich daran, mehr davon/in dieser Richtung zu tun?
Um „Blockaden“ und Hindernisse auf dem eigenen Weg zu überwinden ist es wichtig, diese erst einmal zu erkennen. Eng damit verwandt ist auch die folgende Frage: - Was muss passieren, damit ich in meinem beruflichen Alltag möglichst oft das tun kann, was mir am meisten liegt / was mir am wichtigsten ist / was ich am besten kann?
Die Hürden auf dem Weg zu den eigenen Zielen liegen ja nicht nur bei uns selbst. Daher ist es wichtig, das (aktuelle und zukünftige) berufliche Umfeld einmal unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten und zu schauen, welche Faktoren aus dem beruflichen Umfeld hemmend und welche unterstützend wirken. - Wer oder was könnte mir dabei helfen, hier weiter zu kommen?
Sich dieser Ressourcen und „Unterstützer“ bewusst zu werden ist wichtig – denn Selbstführung heißt nicht, alles auch alleine machen oder schaffen zu müssen! - In welchen Punkten habe ich mich bereits weiterentwickelt? Was mache ich schon besser als früher?
Selbstführung heißt ja auch immer „innerer Monolog“ und „Feedback an sich selbst“. Und bei diesem Feedback ist es, wie bei jeder Art von Feedback, wichtig, ausgewogen zu sein und nicht nur auf das zu schauen, mit dem man noch unzufrieden ist und das man besser machen möchte, sondern immer auch auf das zu schauen, was man schon erreicht hat; auf das, was man schon gut oder zumindest besser als früher macht. - Und wo kann / will / sollte ich mich noch weiterentwickeln?
Was würde mir dabei helfen? - Was sind meine Kompetenzen? Was kann ich besonders gut?
Das müssen nicht nur konkrete fachliche Dinge sein. Auch „abstrakte“ oder breiter angelegte Dinge wie „einfache Lösungen für komplexe Probleme finden“, „unterschiedliche Positionen und Meinungen zusammenbringen / integrierend wirken“ oder „mit einer neuen Sichtweise an ein Problem herangehen und so kreative Lösungen finden“ sind hier relevant).
3. Ressourcen, Lernen und Entwicklung betreffend:
Nachdem der „Kompass“ eingestellt ist und man Orientierung hat, bezüglich sich selbst, des Weges, den man gehen möchte und der Ziele, die man anstrebt, gelten die weiteren Fragen den konkreten, kleinen Handlungs- und Entwicklungsschritten im beruflichen Alltag:
- Was habe ich heute gut gemacht? Worauf kann ich stolz sein?
- Wofür bin ich dankbar?
- Was hätte ich heute gerne anders gemacht?
- Was möchte ich als nächstes lernen / wo möchte ich mich als nächstes verbessern? Mit wem möchte ich einen Konflikt beilegen?
- Welches Verhaltensmuster, welche Reaktionen möchte ich gerne „verlernen“ und nicht mehr praktizieren?
- Was habe ich heute lernen können?
- Worüber habe ich mich von Herzen gefreut?
Was hat mich bewegt? (Im positiven wie im negativen Sinne). Was war emotional wichtig für mich?
Was gibt mir Kraft?
Hier entsteht also Tag für Tag mehr als nur eine simple „To-Do“-Liste oder eine „Stop-Doing“-Liste. Es geht einfach darum, regelmäßig kurz innezuhalten und bei Aller Arbeit und Aktivität immer wieder zu schauen: „Was mache ich hier genau?“ „Möchte oder sollte ich das so weitermachen?“ „Was kann ich mir bewahren und was möchte ich gerne hinter mir lassen?“ „Warum mache ich das so, wie ich es mache?“ und „bringt mich das meinen Zielen näher – oder nicht?“
Es kann zudem hilfreich sein, all diese Dinge nicht nur gedanklich durchzugehen, sondern sie konkret festzuhalten – in einem Tagebuch, digital, in einer selbstdefinierten „Balanced Scorecard“ – was hier für Sie am besten funktioniert, ist egal, Hauptsache, es funktioniert.
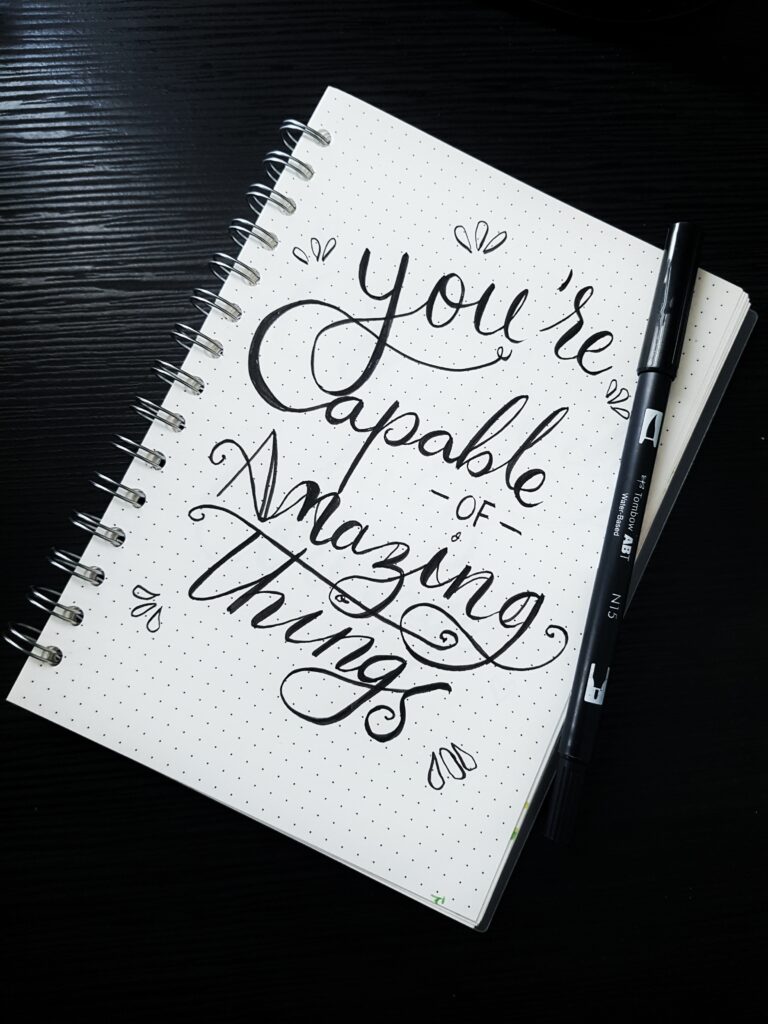
„Tagebuch“ als Hilfsmittel der Selbstführung.
Die regelmäßige Beschäftigung mit diesen Fragen hilft Ihnen, Ihren Zielen näher zu kommen und im Beruf zufriedener zu sein. Und diese Art der Selbstführung hilft nicht nur Ihnen: Auch Ihre Kolleg*innen und die Mitarbeitenden in Ihrem Team werden davon profitieren.
Zusammenfassung: So kann man Selbstführung erlernen und das bringt sie uns
„Studien konnten zeigen, dass die erfolgreiche Ausübung von Selbstführung mit höherer Leistung und stärkerer Bindung an das Unternehmen zusammenhängt. Vermutlich, weil Selbstführung zu einem Gefühl von Autonomie und Authentizität beiträgt, dem Gefühl, mitbestimmen zu können, wie bei bestimmten Projekten und im Unternehmen allgemein vorgegangen wird. Auch geht aus den Ergebnissen hervor, dass Mitarbeitende in teilautonomen Arbeitsgruppen zufriedener mit ihrer Arbeit sind, wenn ihre Führungskräfte auf das Konzept der Führung durch Selbstführung setzen.“ (Zitiert aus „Selbstführung: Warum sie jetzt besonders wichtig ist und wie man sie erlernen kann“).
Erfolgreiche Selbstführung erhöht die eigene Selbstwirksamkeit und die Umsetzungskompetenz. Sie versetzt uns in die Lage, die eigenen Ressourcen zu kennen, diese zu aktivieren und gezielt für unsere Ziele und das, was uns im (Berufs-)leben wichtig ist, einzusetzen. Durch effektive Selbstführung können Sie berufliche Herausforderungen besser meistern und sind zufriedener im Job und es fällt Ihnen leichter, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und den Fokus auf das Wesentliche nicht zu verlieren.
Außerdem hilft Selbstführung Ihnen dabei, Konflikte zu lösen, und auch bei Schwierigkeiten und in stressigen Situationen einen Weg zu finden, der hilft, Probleme zu lösen. Ihre Konfliktfähigkeit und Ihre Resilienz profitieren also ebenfalls, wenn Sie Selbstführung erlernen und erfolgreich praktizieren.
Fußnote: Potenzialaufbau, Talent Management und Berufliche Orientierung mit DNLA:
Kompakte Informationen zu den gerade genannten Einsatzbereichen der Potenzialanalyse- und Potenzialentwicklungsverfahren DNLA – Discovering Natural Latent Abilities bekommen Sie durch Klick auf die nachfolgenden Grafiken:
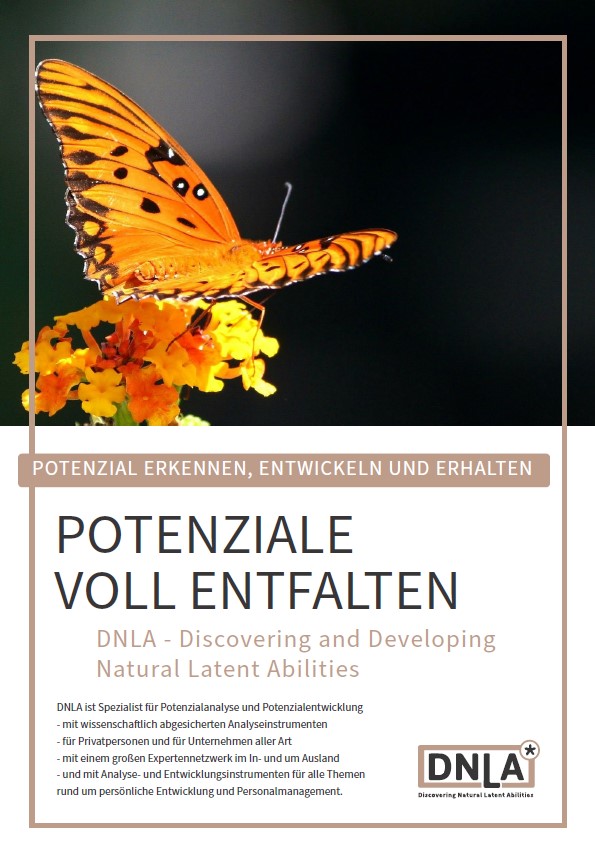
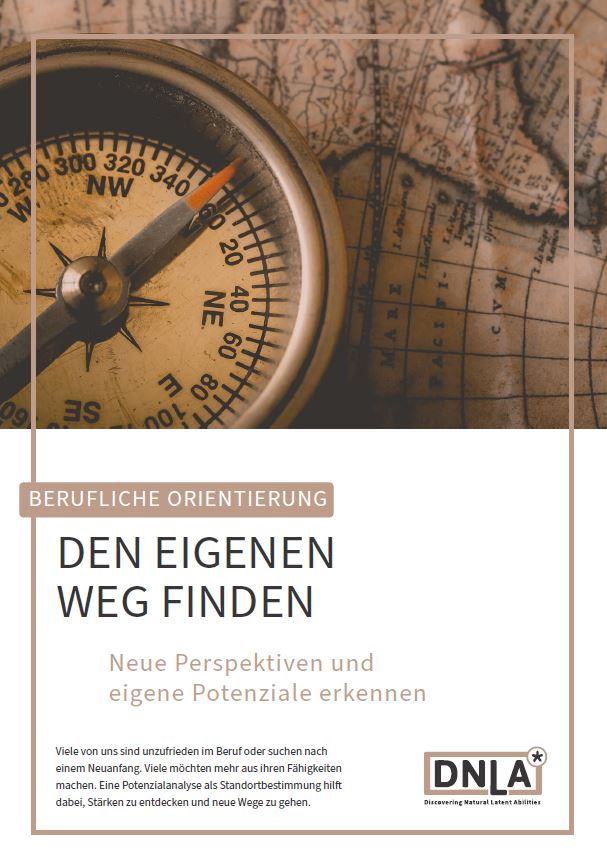
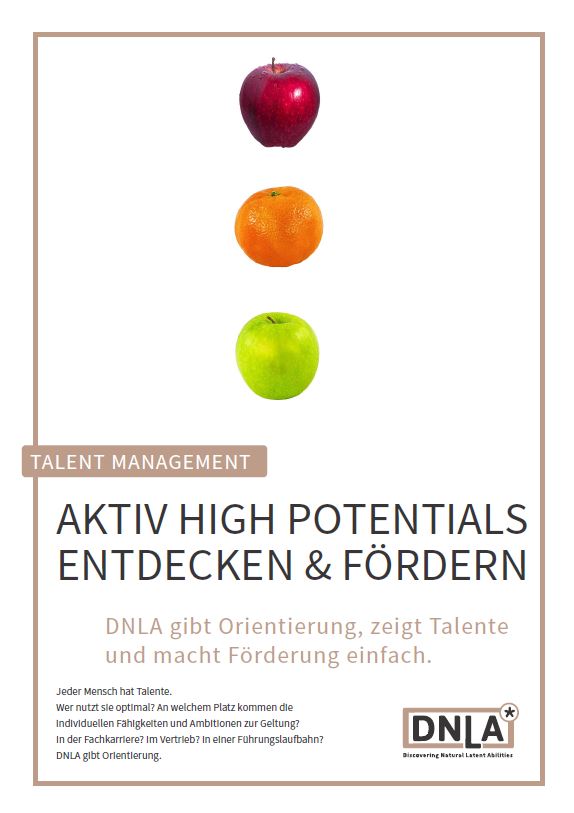
Bindung stärken: „Loyal Leadership“, ein Erfolgsfaktor gegen Personalmangel und Fluktuation
Die Verantwortlichen in zahlreichen Unternehmen suchen händeringend nach Lösungen, wie sie ihre guten Fachkräfte halten können. Eine mögliche Antwort: „Loyal Leadership“. Wir stellen dieses neue Konzept vor und zeigen, wie Führungskräfte auch in schwierigen Zeiten für eine hohe Mitarbeiterbindung sorgen.
Die Situation: Fachkräftemangel und fehlende Bindung
Es war einmal, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, da waren Mitarbeitende stolz darauf, ihr gesamtes Arbeitsleben einem bestimmten Betrieb zu widmen. Ja manchmal war es sogar regelrecht „Familientradition“, dass die Kinder ihre Ausbildung ganz selbstverständlich im selben Betrieb machten, in dem auch schon die Eltern gearbeitet haben.
Was früher häufig anzutreffen war, klingt heute ziemlich märchenhaft. Die Realität fast überall dagegen: Fachkräftemangel. (Mit diesem Thema haben wir uns in letzter Zeit häufiger beschäftigt; siehe „Fachkräftemangel und Qualifizierung: Neue Perspektiven und Impulse“ und „Die Auswirkungen des Fachkräftemangels für Ihr Unternehmen abmildern: So geht´s!“)
Zuerst einmal müssen die Unternehmen viel Mühe und Zeit investieren, um überhaupt geeignete Leute zu finden oder auszubilden. Und viel zu häufig sind diese dann schon viel zu früh wieder weg. Das Problem aus Sicht der Unternehmen: Es fehlt an einer wirklichen, inneren Bindung zum Arbeitgeber und zur eigenen Aufgabe. Die Verluste, die dadurch entstehen, sind enorm, und auch dieses Thema haben wir schon ausführlich beschrieben (siehe dazu den Beitrag: „Enorme Verluste: Das Potenzial der Unternehmen und der Mitarbeitenden wird nicht genutzt.“)

Gründe für den Mangel an Loyalität:
Loyalität kann man nicht einfach verlangen. Auch „kaufen“ kann man sie nicht. Sie muss wachsen – und sie ist immer gegenseitig: Loyalität entsteht dadurch, dass die Mitarbeitenden sich vom Unternehmen als Menschen ernst genommen fühlen. Die Basis für Loyalität entsteht gerade in schwierigen Zeiten, wenn gemeinsam Probleme zu meistern sind und wenn die Mitarbeitenden besondere Rückendeckung brauchen. Die Coronapandemie mit ihren bekannten Auswirkungen war und ist solch eine Situation. Viele Mitarbeitende, die sich mit dieser Situation – dem Home Office, dem Home Schooling, dem Stress – alleine gelassen fühlten, begannen, sich zu fragen: „Was mache ich hier eigentlich?“ „Wofür mache ich das?“ und „Will ich das weiterhin so machen?“. Die Loyalität wird untergraben, die Konsequenz für viele Betroffenen: „Berufliche Neuorientierung in und nach der Coronazeit“
An Umständen wie der Coronakrise kann man nichts ändern. Wohl aber an ihren Auswirkungen im Unternehmen. Und hier wurden die entscheidenden (Führungs-)Fehler gemacht. Loyalität ist also nicht einfach „verloren gegangen“ – sie wurde verspielt.
Häufig anzutreffende „Loyalitätskiller“ sind:
- Unfairness und ungerechtfertigte Ungleichbehandlung
- zu viel Kontrolle, Misstrauen, zu geringe Handlungsspielräume
- mangende Einbeziehung und das Vorenthalten wichtiger Informationen
- ein Mangel an Wertschätzung für das bereits Geleistete; Zweifel an Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden
- Situationen, in denen das Vertrauen der Mitarbeitenden enttäuscht wird (wie z.B. nicht eingehaltene Versprechungen)
- Organisationsmängel, unklare Aufgabenverteilung, und daraus resultierend: Frust, Druck und Stress
Loyal Leadership – so kann man Loyalität aufbauen
Höchste Zeit also für neue Lösungen. Was kann man tun? Eine – neue – Antwort: „Loyal Leadership“.
Vorgestellt wird das innovative Konzept „Loyal Leadership“ als Titelthema in der neuesten Ausgabe der managerSeminare 298. Miriam Engel, DNLA-Partnerin und Gründerin von „loyalworks“ erläutert hier das Grundprinzip der loyalen Führung und erklärt, worauf es beim Thema „Loyal Leadership“ ankommt.

Wer das Ganze nicht nur nachlesen möchte, sondern lieber „auf die Ohren“ bekommt, dem empfehlen wir die Podcasts von managerSeminare mit der aktuellen Folge „Schlüsselfaktor Loyal Leadership: Mitarbeitertreue in der Krise„.
Loyal Leadership im Schnelldurchlauf
Für diejenigen, die weder Zeit für den ausführlichen Text noch den Podcast finden hier schon einmal „Loyal Leadership“ im Schnelldurchlauf.
Loyalität ist ein Gefühl der Verbundenheit, das auch dann noch trägt, wenn für einen selbst nicht alles nach Wunsch läuft. Diese echte Bindung und Loyalität entsteht insbesondere dann, wenn Unternehmen gemeinsame Werte mit den Mitarbeitenden teilen und sich ihrerseits ihnen gegenüber loyal verhalten. Denn hier gilt: „Wie du mir, so ich dir“: Nur wer loyal führt, wird loyale MitarbeiterInnen bekommen!
Solch loyales Verhalten führt zum Aufbau eines „Vertrauenskontos“: Man ist bereit, eine Zeit lang Nachteile, wie zum Beispiel schwierige Arbeitsbedingungen, in Kauf zu nehmen, weil man sich dem Unternehmen insgesamt und dem, wofür es steht, verpflichtet – „committed“ und emotional verbunden fühlt.
Extrem wichtig sind in diesem Zusammenhang die Führungskräfte und die Art, wie sie sich den Mitarbeitenden gegenüber verhalten. „Loyal Leadership“ heißt, sich den Mitarbeitenden gegenüber kompetent und integer zu verhalten. Dazu gehören beispielsweise:
- … Aufstiegsmöglichkeiten, Karriereperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen…
- … und dabei nur das zu versprechen, was man zuverlässig auch halten will („Reliabilität“).
- … – gerade in schwierigen Zeiten – offen und transparent zu sein. Erwartungen müssen geklärt werden, schwierige Entscheidungen müssen richtig kommuniziert werden.
- … ehrlich und aufrichtig zu sein und, beispielsweise, eigene Fehler zugeben können.
- … die Mitarbeitenden mit Respekt zu behandeln und sie nicht auszunutzen. Dazu gehört beispielsweise auch, Rücksicht auf die Grenzen der Mitarbeitenden nehmen; Schwächen und besondere Umstände zu berücksichtigen.
- … das Team wenn nötig fachlich zu unterstützen und den Mitarbeitenden persönlich Rückendeckung zu geben.
- … und, ganz wichtig: Um Loyalität von Seiten der Mitarbeitenden aufzubauen, ist es elementar, ihnen einen Vertrauensvorschuss zu geben und den Mitarbeitenden Handlungs- und Entscheidungsspielräume einzuräumen.
Alleine durch diese kurze Zusammenfassung wird klar: Das sind ganz schön hohe Anforderungen an die Führungskräfte.
Loyal Leadership aufbauen – so geht´s
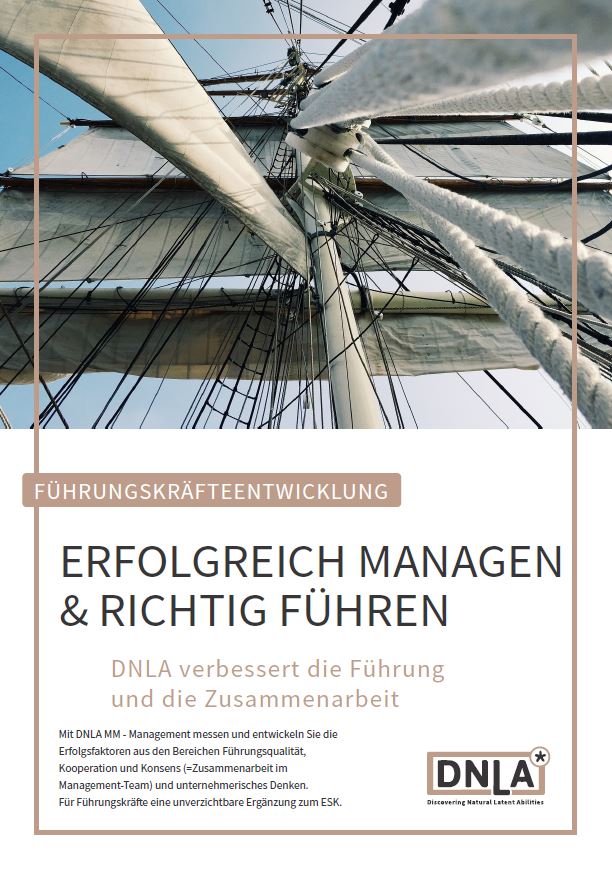
Qualitäten wie Einfühlungsvermögen und eine gute Kontaktfähigkeit; die Fähigkeit, Mitarbeitende einzubeziehen und ihnen Vertrauen entgegenzubringen und Verantwortung zu übertragen oder den richtigen Umgang mit Fehlern (auch den eigenen) kann man trainieren und fördern. Solche Sozial- und Managementkompetenzen lassen sich gezielt aufbauen und stärken. Die DNLA-Programme ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz und MM – Management und Führung haben sich hier schon vielfach bewährt.
Mit ihnen, und den darauf aufbauenden Entwicklungsgesprächen und gezielten Fördermaßnahmen kann man die Kompetenzen, die für das erfolgreiche Praktizieren von „Loyal Leadership“ benötigt werden, gezielt aufbauen.
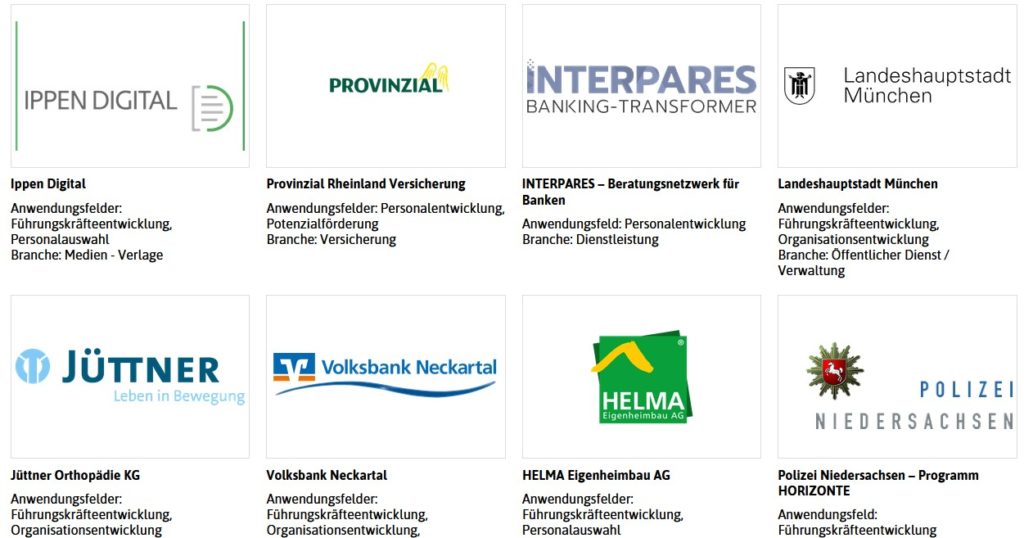
Und genau aus diesem Grund gibt es sogar einen eigenen IHK-zertifizierten Lehrgang „Loyale Führung“, bei dem wiederum die DNLA-Analysen ein wichtiger Baustein sind.

Informieren Sie sich und lernen Sie mehr über „Loyal Leadership“ – denn das zahlt sich aus: Durch loyale Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung, gegenseitiges Vertrauen, und echte Motivation.
Sind Sie fit für die Generation Z? Ein DNLA-Test für Führungskräfte
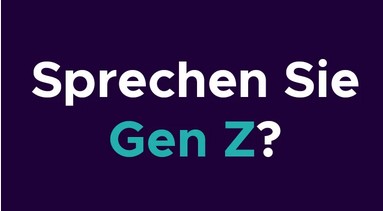
Generation Z: Eine Herausforderung für Führungskräfte
Eine junge Generation mit eigenen prägenden Erfahrungen, eigenen Werten und Vorstellungen drängt auf den Arbeitsmarkt. Und das unter neuen Rahmenbedingungen, in einer Zeit der wirtschaftlichen und sonstigen Krisen und des Fachkräftemangels.
Das stellt die Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Wir zeigen, wie man ihnen begegnet.
Generation Z: Was (oder besser: Wer?) ist das?
So ganz einheitlich festlegen kann man das nicht. Über die „Generation Z“, oder auch die „Post-Millenials“ wird viel diskutiert und geschrieben (zum Beispiel kürzlich in der NZZ, unter der Überschrift „Generation Z im Arbeitsmarkt: Faul sind nur die Vorgesetzten“ – und nicht die jungen Arbeitnehmer, die sich manchmal sagen lassen müssen, sie seien faul, verwöhnt und mit sich selbst beschäftigt) aber leider noch zu wenig geforscht. So sind die Erkenntnisse über diese Generation im Bezug auf das Arbeitsleben noch unsicher und eher schlaglichtartig. Sicher ist:
- Die „Generation Z“ ist die erste, die komplett im Zeitalter der digitalen Technologien und des Internets aufwächst und von Anfang an damit vertraut ist.
- Was den Arbeitsmarkt angeht, so prägt der Fachkräftemangel und daraus folgend die Verwandlung des „Arbeitgebermarktes“ in einen „Arbeitnehmermarkt“ das Bild.
Aus diesen generationenprägenden Rahmenbedingungen und Erfahrungen ergeben sich einige deutlich erkennbare Trends:
- Ein klarer Fokus auf Familie und Privatleben. Der Beruf steht erst an zweiter Stelle.
- Die klare Trennung zwischen Privatleben und Beruf anstatt „Work-Life-Blending“.
- Wichtige Werte sind Harmonie, Sinn, Altruismus, Hilfsbereitschaft und Toleranz sowie Gerechtigkeit.
- Es gibt, bei der Arbeit wie im Berufsleben, ein starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit, Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung.
- Die Arbeit soll Spaß machen, sinnvoll und abwechslungsreich, spannend und herausfordernd sein und den eigenen Neigungen bzw. Fähigkeiten entsprechen. Man möchte gerne seine eigenen Ideen mit einbringen, und oft auch kreativ und innovativ intrinsisch motiviert arbeiten.
- Teils sind die Erwartungen aber auch widersprüchlich: So besteht sowohl der Wunsch nach festen Arbeitszeiten (also in dem Sinne, dass der Arbeitgeber nicht einfach Überstunden von einem einfordern kann) – gleichzeitig aber auch nach Flexibilität (für eigene Belange, zum Beispiel, wenn etwas mit der Familie ist).
- Die Wahlfreiheit, sowohl was Arbeitsort und Arbeitszeit angeht, aber auch was die Auswahl der genauen Arbeitsinhalte und Tätigkeiten oder die Teamzusammenstellung angeht, wird wertgeschätzt und ist ein stark motivierender und Begeisterung / Bindung erzeugender Faktor.
- Die emotionale Bindung ans Unternehmen ist bei den jüngeren Generationen nicht sehr stark ausgeprägt. Dadurch sind sie wechselwilliger, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden. (Siehe „Deloitte Millennial Survey 2022“).
- Gleichzeitig erwarten oder erhoffen sie sich Arbeitsplatzsicherheit, Kontinuität, und Loyalität und Verlässlichkeit von Seiten der Arbeitgeber.

Die Generation Z im Unternehmen: Neue Herausforderungen für Führungskräfte.
Die Anforderungen und Erwartungen der Generation Z am Arbeitsplatz stellen Führungskräfte auf jeden Fall vor neue Herausforderungen. Daher heißt es für sie: umdenken. Für die Unternehmen und Führungskräfte, die damit nicht umgehen können, wird das zum Problem. Für die Unternehmen und Führungskräfte aber, die die Menschen der Generation Z verstehen und richtig auf sie eingehen können, ist die Situation auch eine große Chance.
Anforderungen an die Arbeitsumgebung und an die Führungskräfte: So kann man mit der Generation Z richtig gut zusammenarbeiten.
- Führung und Förderung, Partizipation und persönliche Perspektiven:
Die Angehörigen der Generation Z, die 16- bis 28-Jährigen, möchte sich bei der Arbeit weiterentwickeln und selbst verwirklichen und sie möchte eigenverantwortlich arbeiten. Entsprechende Förderung und Perspektiven sind wichtig. Eigenverantwortliches, agiles Arbeiten und flache Hierarchien und ein mitarbeiterzentrierter, partizipativer Führungsstil sind hierbei hilfreich.
Außerdem entscheidend: Einbeziehung, und den Sinn einer Aufgabe und ihren Beitrag zum Erfolg des Gesamtunternehmens erklären. - Dialog und (Selbst-)reflexion:
Eine gute Führungskraft darf sich nicht nur auf das Management des Tagesgeschäfts konzentrieren. Dialog, Standortbestimmung, Teamreflexion und Selbstreflexion sind wichtig, um den Draht zu den Teammitgliedern zu behalten und gemeinsame Perspektiven zu erarbeiten. - Flexible Lösungen und neue Arbeitsformen:
Um dem Wunsch der Generation Z gerecht zu werden, genug Zeit zu haben für Familie, Freunde und Privatleben, ist es wichtig, die (Zusammen-)arbeit nicht nur nach dem alten „5-Tage-im-Büro-Modell“ zu organisieren, sondern kreativ zu werden und gemeinsam die passenden Arbeitsformen und Arbeitsmodelle zu finden. - Gute Kommunikation und gute Zusammenarbeit:
Der Umgang miteinander sollte respektvoll, offen und ehrlich sein. Wichtig ist dabei jedoch, dass auch im Fall von Problemen oder Kritik die Kommunikation stets wertschätzend bleibt. Das Ziel ist, dass die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden.
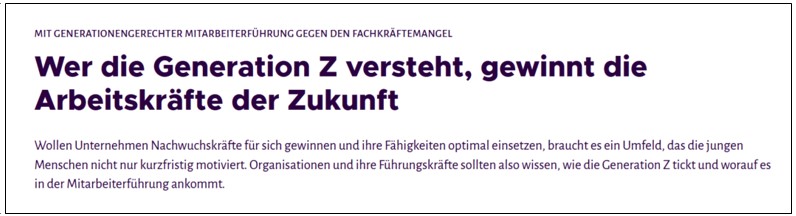
Ausführlich geschildert finden Sie diese Zusammenhänge im Artikel „Wer die Generation Z versteht, gewinnt die Arbeitskräfte der Zukunft: Mit generationengerechter Mitarbeiterführung gegen den Fachkräftemangel“, auf dem die Zusammenfassung in diesem Abschnitt basiert.
Wie gut sind Sie als Führungskraft aufgestellt für die Generation Z? Finden Sie es heraus!
Wenn Sie selbst Führungskraft sind oder zukünftig Führungsverantwortung übernehmen sollen, werden Sie sich fragen: Was kann ich nun konkret tun, um mich auf diese neuen Herausforderungen vorzubereiten? Bin ich gut aufgestellt als Führungskraft, auch für die neuen Teammitglieder aus der Generation Z?
Für alle, die das wissen möchten, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit: DNLA hat bei der Entwicklung eines Tests mitgewirkt. Hier beantworten Sie 16 Fragen, und erhalten im Anschluss daran eine erste Einschätzung Ihrer Führungsfähigkeiten und zu der Frage, wie gut Sie für die „Generation Z“ aufgestellt sind! Neugierig? Dann los!


Enorme Verluste: Das Potenzial der Unternehmen und der Mitarbeitenden wird nicht genutzt.
Dabei gibt es gute, einfach umsetzbare Lösungen!

Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Arbeitsbedingungen in Deutschland weiterhin mit viel Luft nach oben.
Bericht zum Engagement Index Deutschland 2021
Ungenutzte Mitarbeiterpotenziale und brachliegendes Unternehmenspotenzial: Die Ausgangssituation.
Die Ergebnisse des Human Resources Engagement Index von Gallup, der jährlich in Deutschland und in anderen Ländern erhoben wird, sind weithin bekannt. Kurz gesagt ist es so, dass lediglich gut 15 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich eine hohe emotionale Bindung zu ihrer Arbeit verspüren, gut zwei Drittel verspüren eine mittlere Bindung und der Rest, an die 15 Prozent, verspüren überhaupt keine innere Bindung zu ihrer Arbeit oder haben schon „innerlich gekündigt“. (Details, Quellen und weiterführende Informationen: Am Ende des Textes).
Was bedeuten diese Zahlen?
- …dass die wenigsten Mitarbeitenden wirklich einen Sinn in ihrer Arbeit sehen.
- …dass die meisten eher „Dienst nach Vorschrift“ machen
- und dass viele sogar schon regelrecht entfremdet sind von ihrer eigenen Arbeit.
Auch die Gründe dafür sind schon seit langem bekannt: Es fehlt an Einbeziehung, Anerkennung und Wertschätzung. Und oft genug ist für die Mitarbeitenden selbst auch einfach nicht klar erkennbar, was ihr persönlicher Beitrag zum Erfolg des Gesamtunternehmens ist.

Ungenutzte Mitarbeiterpotenziale und brachliegendes Unternehmenspotenzial: Die Folge: Enorme Verluste und Schäden.
Der Schaden entsteht auf allen Ebenen:
- Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie leiden täglich unter der unbefriedigenden Arbeitssituation, der fehlenden Einbindung und Anerkennung, den Führungsfehlern.
- Für die Unternehmen. Auch sie leiden in mehrfacher Hinsicht. Die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist umso geringer, je niedriger die emotionale Bindung ans Unternehmen ausfällt.
Die Gefahr, dass diese Mitarbeitenden ausfallen oder zu anderen Arbeitgebern wechseln, ist sehr groß. „Wer nun glaubt, um die innerlich Gekündigten sei es nicht schade, sie könnten ruhig weiter ziehen, der irrt. Marco Nink vom Beratungsunternehmen Gallup: „Oft sind unter diesen Mitarbeitern viele fähige Personen, die man nicht verlieren möchte – zum Beispiel Talente, Leistungsträger oder Fachexperten. Innere Kündigung ist immer das Ergebnis schlechter Führung und im Unternehmen ein hausgemachtes Problem.“ Jeder tritt zu Beginn zunächst mal motiviert in seinem Unternehmen seine Stelle an – und verliert dann seinen Glauben wegen der Führung, die er im Unternehmensalltag erlebt.“ (Siehe Gallup-Studie 2019: Rund sechs Millionen Beschäftigte glauben nicht an ihr Unternehmen – mit 122 Milliarden Euro Folgeschäden, schuld sind die Führungskräfte selbst | Management-Blog (wiwo.de)). - Aus dieser persönlichen und betriebswirtschaftlichen Belastung wird auch eine gesamtgesellschaftliche. Denn der volkswirtschaftlicher Schaden, der sich aus den Führungsfehlern und aus der fehlenden emotionalen Bindung ergibt, beträgt bis zu 122 Milliarden Euro jährlich, rechnet Gallup vor.
Ungenutzte Mitarbeiterpotenziale und brachliegendes Unternehmenspotenzial: Die Ursache: Führungsfehler und als Resultat ein schlechtes Arbeitsumfeld.
„Führungskräfte müssen sich bewusst sein, dass sie diejenigen sind, die durch ihr Verhalten einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Denn emotionale Bindung wird im unmittelbaren Arbeitsumfeld erzeugt.“ sagt Marco Nink, Director of Research and Analytics EMEA bei Gallup.
Angesichts der jährlich aufs Neue zu beobachtenden Ergebnisse aus den Studien zum Gallup Human Resources Engagement Index wird klar, dass der Großteil der Führungskräfte hiermit nicht oder höchstens teilweise erfolgreich ist.
Doch jetzt auf die Führungskräfte einzudreschen und Ihnen alleine die „Schuld“ an den Zuständen in den Unternehmen zu geben greift zu kurz. Denn diese werden oft nicht ausreichend auf ihre Führungsaufgaben bzw. auf geänderte Anforderungen in der heutigen, sich immer schneller ändernden Arbeitsumgebung und in den heutigen Krisenzeiten (siehe dazu auch: Arbeiten in Krisenzeiten: Welche Soft Skills jetzt gefragt sind) vorbereitet. Und häufig werden sie auch von ihren eigenen übergeordneten Führungskräften alleine gelassen. Gerade bei Themen der Mitarbeiterführung herrscht manchmal noch die Ansicht, dass sich diese schon irgendwie so „nebenbei“ machen ließen. Also brauchen Führungskräfte nicht zusätzlich noch Schelte und Druck – sondern vielmehr Unterstützung und Anleitung.
Ungenutzte Mitarbeiterpotenziale und brachliegendes Unternehmenspotenzial: Die Lösung: „Gute Führung“ – den Führungskräften helfen, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu erkennen und zu adressieren.
Das sieht auch Nink so: „Führungskräfte müssen befähigt werden, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu adressieren. Chefs müssen wissen, auf was es ankommt“, appelliert er. (Siehe hier).
Und was wäre dazu besser geeignet als DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz und DNLA MM – Management und Führung?
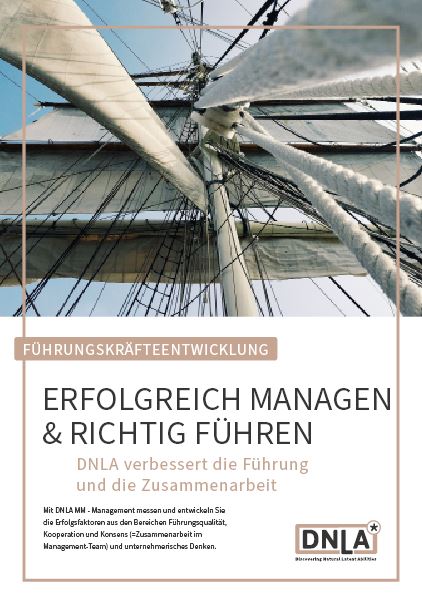
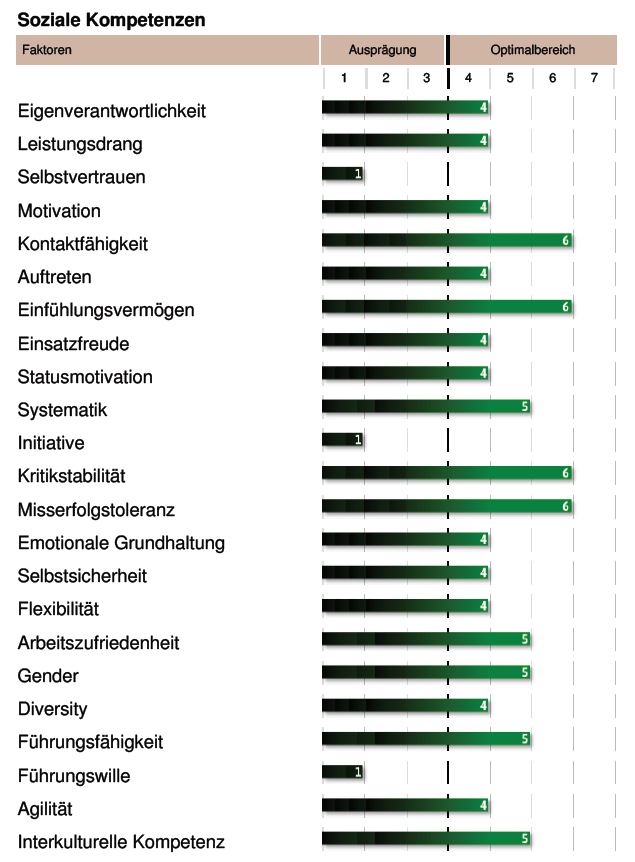
Ungenutzte Mitarbeiterpotenziale und brachliegendes Unternehmenspotenzial: Lösungsansätze: So kann man ungenutzte Potenziale wieder aktivieren.
Die Frage ist natürlich, was man darüber hinaus noch tun kann, um die Situation für die Unternehmen und für die Beschäftigten zu verbessern?
Nun, so kompliziert ist das gar nicht:
- Zunächst muss man wissen, wie genau die Situation im Unternehmen und für jede Einzelne und für jeden Einzelnen ist. Zum Thema Situationsanalyse und Bestandsaufnahme gleich mehr.
- Nach der Situationsanalyse müssen passende Entwicklungsmaßnahmen folgen, auf allen Ebenen, für die Einzelne oder den Einzelnen, für Teams und Arbeitsgruppen und für das gesamte Unternehmen.
a) Bestandsaufnahme
- Eine einfache und schnelle Bestandsaufnahme bieten die „16 Begeisterungsfragen“ unseres Kollegen Robert Berkemeyer. Sie bieten einen schnellen Einstieg in die Beratung und in notwendige Entwicklungsprozesse.
- Ein wenig weiter geht die Wertschöpfungsanalyse – eine einfache Methode zur Berechnung des ungenutzten Potenzials im Unternehmen. Eine vereinfachte Version dieser Analyse kann man sogar selbst im Internet durchführen, und zwar auf der Seite www.personalbilanz.de hier beim „Wertschöpfungsrechner„. Kurz gesagt wird dabei anhand des Niveaus der emotionalen Bindung und der Produktivitätsverluste, die dadurch entstehen, in Relation zu den durchschnittlichen Mitarbeiterjahreskosten errechnet, wie viel durch Führungsfehler und Motivationsmängel brachliegendes Potenzial sich im Unternehmen befindet und wieder aktiviert werden kann.
Ein Konzept, um genau dies in die Praxis umzusetzen, ist die DNLA Personalbilanz.
b) Entwicklung
- Der nächste daran anschließende Schritt ist die DNLA Personalbilanz. Sie ist zweierlei: Eine Methode zur Sichtbarmachung der Situation im Unternehmen und der Mitarbeiterpotenziale sowie ein effektives Instrument zur Organisationsentwicklung.

Wer sich eingehender über die Personalbilanz informieren will, hat drei Möglichkeiten:
- Im hier verfügbaren Factsheet zur Personalbilanz.
- Hier auf der DNLA-Webseite… Personalbilanz für erfolgreiche Unternehmen – DNLA
- …und auf der eigenen Webseite der Personalbilanz, Personalbilanz • Personalbilanz
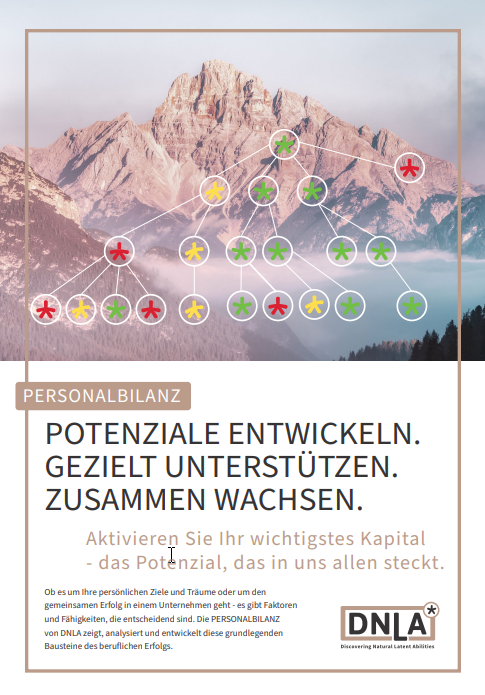
Quellen und weiterführende Literatur:
- Engagement Index: https://www.gallup.com/de/engagement-index-deutschland.aspx
- Gallup Deutschland
- Mitarbeiterbindung und Unternehmenserfolg: Rechsteiner, F. (2017). Mitarbeiterbindung wirkt sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus. In: Kulturbasiertes IT-Recruiting. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54680-2_8 -> Mitarbeiterbindung wirkt sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus | SpringerLink
DNLA „Inside Heath Care“
Klaus Haddick über Leadership, Soft Skills und Potenzialdiagnostik und -entwicklung im Gesundheitswesen
„Inside Health Care“ – der neue Podcast für das Gesundheitswesen
Der Podcast „Inside Heath Care“ von DNLA-Partner Frank Bauernfeind behandelt aktuelle Themen aus dem Gesundheitswesen. „Die aktuelle Situation in der Pflege“ oder „die Pandemie und das Gesundheitssystem“, so lauten die Titel einiger Folgen. Es geht dabei um Themen, die diese Personen
umtreiben, die Geschichten, die sie zu erzählen haben, aber auch um die Interviewpartner selbst, dem Menschen hinter seiner beruflichen Rolle.
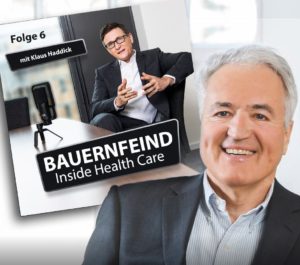
In seinen Podcast lädt Frank Bauernfeind, Personalberater für Krankenhäuser, interessante
Persönlichkeiten, die spannendes aus der Krankenhauswelt zu erzählen haben, zum Gespräch ein.
Dann geht es um aktuelle Themen, die die heutige Situation im Gesundheitswesen betreffen, genauso aber auch um wichtige Zukunftsthemen.
Frank Bauernfeind ist jemand, der gerne ein wenig über den Tellerrand hinausblickt. Das merkt man auch an der Auswahl einer Gäste und Themen.
„Inside Health Care“ und die Frage: „Sind die Themen Personalentwicklung und Leadership schon im Krankenhaus angekommen?“
So kommt in der aktuellen Folge des Podcasts dann auch kein Mediziner zu Wort, sondern ein Pädagoge.

Klaus Haddick, Inhaber und Geschäftsführer der DNLA GmbH (früher: GMP – Gesellschaft für Management und Personalentwicklung) zu Wort. Er und Frank Bauernfeind sprechen über aktuelle HR-Themen im Krankenhaus. Gerade die Frage, ob die Führungskräfte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ihrer Rolle heute noch gerecht werden, wie man die Zusammenarbeit verbessern und sowohl den Führungskräften als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterstützung geben kann.
Das Ganze ist fachlich fundiert und mit Tiefgang – aber auch sehr unterhaltsam, etwa, wenn es darum geht, wie wohl die Potenziale und Entwicklungsfelder von Prof. Karl-Friedrich Börne aus dem Münsteraner-Tatort aussehen würden. 😉
Neugierig geworden? Dann hören Sie gleich rein in die aktuelle Folge des Podcasts „Bauernfeind – Inside Health Care“ mit dem Titel #06 Klaus Haddick – Potenzialdiagnostik und Leadership, die 31 Minuten spannende Inhalte und Perspektiven bietet – und ganz am Ende noch ein besonderes „Bonbon“.
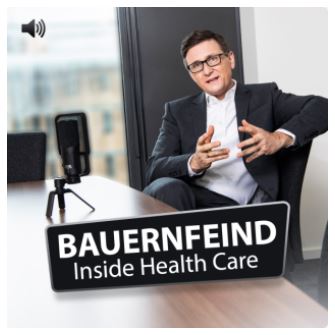
-> HIER geht´s direkt zu dem Podcast.
Soft Skills – Schlüssel zum Erfolg im Sport.
Große Ziele, und wie Soft Skills helfen, sie zu erreichen.

Winterspiele 2022

Aktuell finden die XXIV Olympischen Winterspiele in Peking statt. Ende des Jahres wird noch die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Katar folgen. Zwei sportliche Großereignisse – beide sicher auch, angesichts der Begleitumstände und der Austragungsorte ein fragwürdiges Vergnügen. Für die Athleten und Mannschaften, die um Titel und Erfolge kämpfen jedoch sind sie ganz klar ein, vielleicht DAS Highlight ihrer bisherigen Laufbahn.
Also gilt es auf den Punkt fit zu sein. Neben dem „klassichen“ Training und Faktoren wie Athletik, Technik und Taktik wird es immer wichtiger, die mentalen Faktoren, die Soft Skills zu trainieren.
DNLA SKS – Soziale Kompetenz im Sport
DNLA hat in diesem Bereich schon viel Erfahrung vorzuweisen. Aus der Potenzialanalyse DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz wurde ein eigenes Instrument entwickelt, DNLA SKS – Soziale Kompetenz Sport. Es ist konzipiert für Trainer, Spieler und Athleten, für Profis und Talente aus dem Nachwuchsbereich. Sie alle können mit DNLA SKS entscheidende Erfolgsfaktoren aus dem Bereich der Soft Skills wie Selbstvertrauen, Auftreten, Einsatzfreude oder Misserfolgstoleranz messen und, dort wo es nötig ist, gezielt entwickeln.
Praxisprojekte und Publikationen mit DNLA SKS – Soziale Kompetenz im Sport.
Mit Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung als Trainingsaspekt und Erfolgsfaktor im Wettkampf beschäftigen wir uns schon sehr lange.
Ob in Vorträgen an der deutschen Sporthochschule in Köln oder beim Internationalen Trainerkongress (ITK) des Deutschen Fußballbundes:
– ITK – Persoenlichkeitsentwicklung als Trainingsaspekt und Erfolgsfaktor im Wettkampf (Artikel)
– https://www.youtube.com/watch?v=4NmmwmjQJCk (Video vom kompletten Vortrag beim ITK)
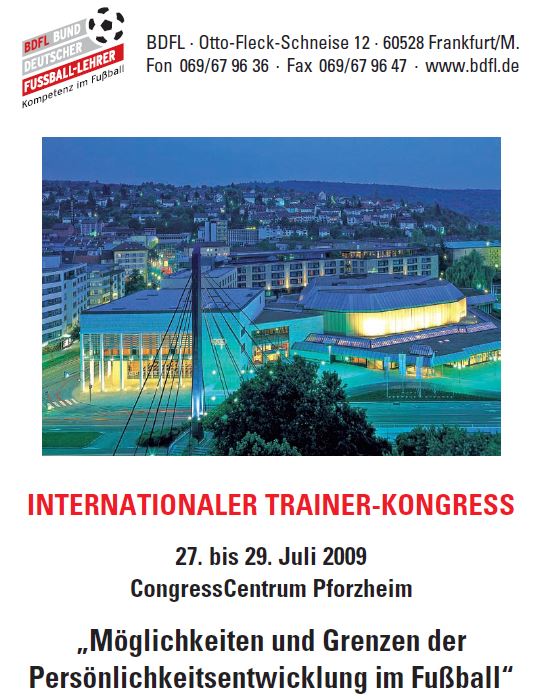
oder in verschiedenen Fachpublikationen:
- im Bereich Sportpsychologie, wie im Beitrag Sport Potenzialanalysen: Die Auswertung liegt vor – und nun? in der Zeitschrift Coaching Area (Download hier)
- in Fachbeiträgen für Fußball wie z.B. Die Persönlichkeit des Spitzenfußballers als Trainingsaspekt (Download hier)
- in Fachzeitschriften für Tischtennistrainer wie dem VDTT-Trainerbrief z.B. hier im Beitrag DNLA – Trainiere deinen Kopf (Download hier)
- und in der Fachzeitschrift „Forward“ im Basketball wie z.B. hier im Beitrag „Die Entschlüsselung der Persönlichkeit“ (Download hier).
Auch in ein Fachbuch, Fussball – Kondition – Technik – Taktik und Coaching, ein Standardwerk für Fußballtrainer, ist DNLA schon eingeflossen.

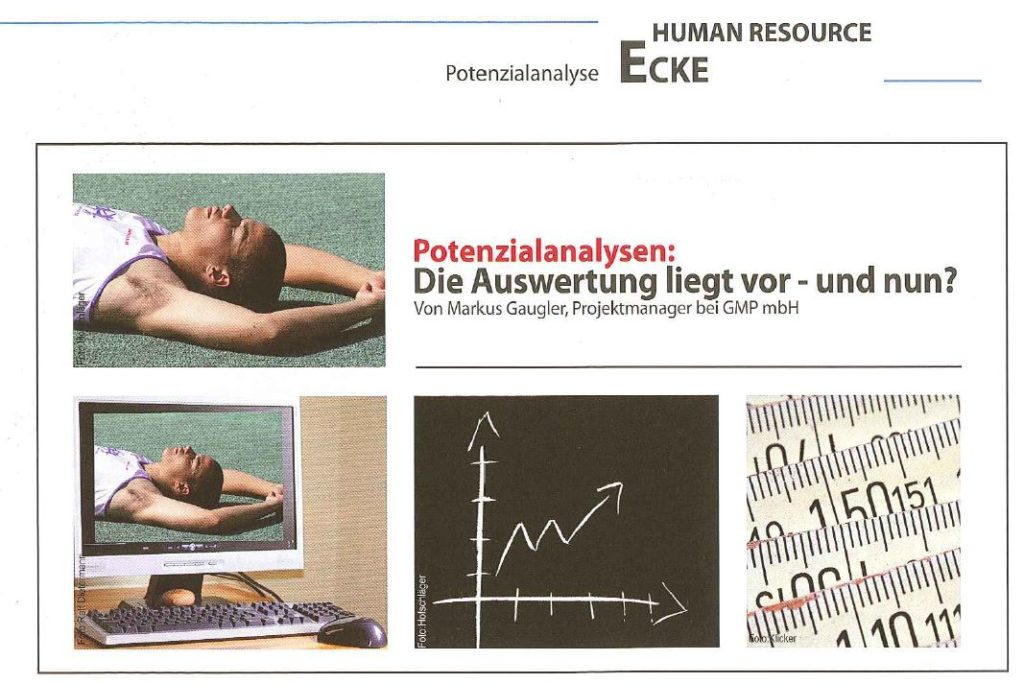
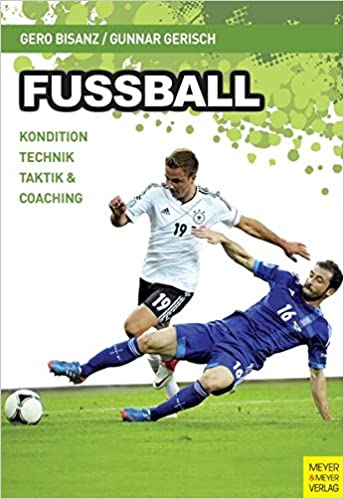
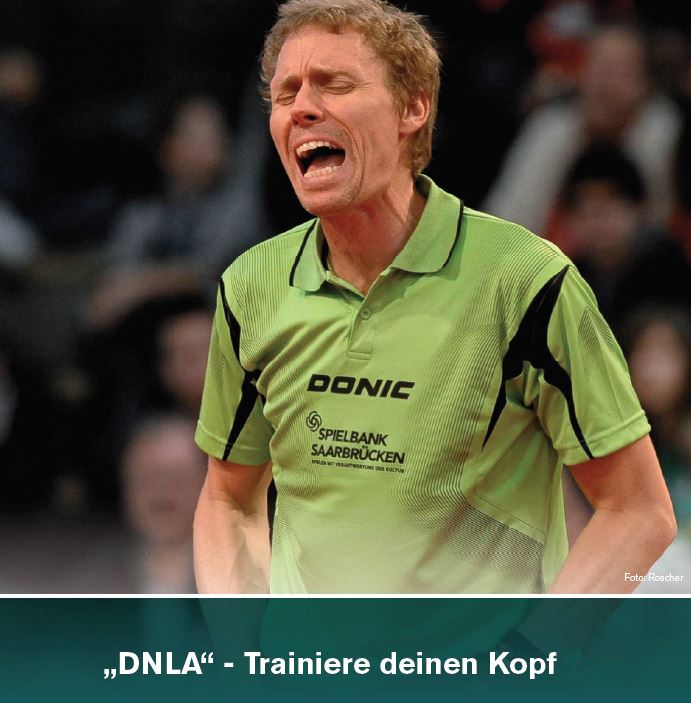

Sogar ein Radiobeitrag des WDR beschäftigte sich mit DNLA und mit der Arbeit, die wir mit Spieler*innen und Trainer*innen machen. Den Beitrag aus dem Jahr 2006 finden Sie hier:
Natürlich haben die Akteure seit damals gewechselt und der Fußball-Bundestrainer ist mittlerweile ein anderer. Aber top aktuell sind die Themen, die in dem Radiobeitrag zur Sprache kamen, immer noch.
Und seit damals gab und gibt es immer wieder DNLA-Projekte im Sport. Im Reitsport, bei Golfern, bei Badmintonspieler*innen und Trainer*innen, bei Nachwuchsteams von Profimannschaften im Damen-Fußball oder natürlich im Basketball, wo wir bei Nachwuchsmannschaften und als Sponsor von BBU01 ratiopharm Ulm junge Talente begleiten.
Soft Skills und Soziale Kompetenz im Sport – ein Thema, von dem alle profitieren
Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja, angeregt durch diesen Beitrag, die oder der nächste, die oder der ein Projekt in diesem Bereich initiiert? Denn eines ist klar: Alle, die an solch einem Projekt beteiligt sind, profitieren davon:
- die Trainer*innen und Betreuer*innen, denn sie bekommen wichtige Impulse und Informationen für die Arbeit mit den Profi- und Nachwuchssportler*innen.
- Die Sportlerinnen und Sportler selber, da sie in ihrer persönlichen entwicklung unterstützt und individuell gefördert werden
- Die Teams, da sie zusammenwachsen und besser zusammenspielen
- Die Vereine, da sie Potenziale und Talente fördern und die Grundlagen legen für den aktuellen und künftigen sportlichen Erfolg.
- Die neteiligten (Beratungs-)unternehmen und Sponsoren, da sie positive Entwicklungen unterstützen und damit nach außen hin wahrgenommen werden, als „Entwicklungs-Helfer“ sozusagen
- Die Beraterinnen und Berater, die bei der Umsetzung helfen – da sie spannende Projekte betreuen, interessante Menschen kennen lernen und fördern und aus den Sport-Projekten Dinge mitnehemen, die sich auch auf das normale Business üertragen lassen – und umgekehrt.
Motivation, wie wichtig ist sie?
Was ist überhaupt Motivation?
Motivation ist ein zentrales Konstrukt der Verhaltenserklärung. Die Zielrichtung (Was?), Ausdauer (Wie lange?) und Intensität (Wie stark möchte ich das Ziel erreichen?) sind die wichtigsten motivationsabhängigen Verhaltensmerkmale. Die Art und Weise des Lernverhaltens sind außerdem abhängig von der Motivation. Die Motivation bestimmt, was für Lernstrategien ein/e Schüler*in auswählt (einfaches Auswendiglernen vs. Elaborierte Methoden). Die Lernmotivation wird als Absicht verstanden, spezifische Inhalte oder Fertigkeiten zu lernen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen (Bsp.: eine Klausur zu bestehen). Die Lernmotivation kann aufgeteilt werden in extrinsischer und intrinsicher Motivation.
- Definition Extrinsische Lernmotivation: die Absicht eine Lernhandlung durchzuführen, weil damit positive Konsequenzen herbeigeführt oder negative Konsequenzen vermieden werden.
- Definition Intrinsische Lernmotivation: die Absicht eine bestimmte Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst von positiven Erlebenszuständen begleitet wird.
Intrinsische und Extrinsische Lernmotivation schließen sich nicht gegenseitig aus, und können zum Beispiel gleichermaßen hoch ausgeprägt sein (Mir macht das Bearbeiten von Matheaufgaben sehr viel Spaß vs. Ich möchte in der Matheklausur eine 1 schreiben, damit meine Eltern stolz auf mich sind).

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan
Diese Theorie gilt als die bedeutsamste moderne Theorie der intrinsischen Motivation. Die Komponenten der Theorie sind:
- Kompetenzbedürfnis: Ein Individuum besitzt das angeborene Bedürfnis nach Kompetenz. Das bedeutet sich kompetent und effektiv mit der Umwelt auseinander zu setzten. Dies macht die Wahrscheinlichkeit von intrinsischer Motivation höher, reicht aber nicht aus.
- Autonomie: Ein Individuum muss sich frei von äußerem Druck und selbstbestimmt in seinem Handeln fühlen.
- Soziale Eingebundenheit: Bedingt das Entstehen von eigenem Interesse und die Zugehörigkeit einer sozialen Gruppe.
Diese drei Faktoren können intrinsische Motivation auslösen und können dadurch zum Flow-Erleben führen. (Flow= vollständiges aufgehen in der Tätigkeit, Selbstvergessenheit, Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein und das Gefühl von kompletter Kontrolle). Allerdings kann die intrinsische Motivation durch die Beeinträchtigung der Selbstbestimmung durch eine angekündigte Belohnung (extrinsischer Reiz) herabgesetzt werden.
Dispositionale Motivationsmerkmale
Definition Leistungsmotivation: relativ eindeutig als Streben nach Erreichen oder Übertreffen individueller oder sozialer Gütemaßstäbe, es besteht Konsens darüber, das Leistungsmotiv in ein Annäherungsmotiv („Hoffnung auf Erfolg“) und ein Vermeidungsmotiv („Furcht vor Misserfolg“) unterteilt werden kann.
Zielorientierung: dauerhafte Zielorientierung, die im Gedächtnis repräsentiert ist, die somit dispositionalen Charakter besitzt.
Schüler*innen können unangepasstes Lernverhalten zeigen. Hilflosigkeits- und Bewältigungsorientierte Schüler*innen haben unterschiedliche Lernziele. Während Hilflose Schüler*innen sich eher an Leistungszielen orientieren, also positive Bewertungen der eigenen Kompetenzen anstreben und gleichzeitig negative Bewertungen vermeiden wollen, orientieren sich Bewältigungsorientierte Schüler*innen sich an Lernzielen. Sie streben danach die eigene vorhandene Kompetenz zu erweitern.
Bedeutung der Motivation für Lernen und Leistung
Die Zielorientierung beschreibt interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Bewertung von Leistungen unter der Berücksichtigung einer Annäherungs- und Vermeidungskomponente. Dabei stehen Zielorientierungen dem extrinsischen Leistungsmotiv näher als dem intrinsischem. Lernziele haben mehrere Vorteile gegenüber dem Leistungsziel.
- Günstigere Attribution für Erfolg und Misserfolg.
- Positivere Gefühle gegenüber Lern- und Leistungsaufgaben.
- Vermehrte intrinsische Motivation.
- Größeres Interesse am Lerngegenstand.
- Die Schüler*innen beschäftigen sich intensiver mit Lernmaterial und wenden adäquatere Verarbeitungsstrategien an und sind in ihrer Arbeit ausdauernder.
Daraus lässt sich schlussfolgern, das Vermeidungsleistungsziele sich auf das Lernverhalten auswirken und die Leistung eher negativ ausfällt, während Annäherungsleistungsziele zumindest eine leistungsförderliche Wirkung haben. Dazu kommt das es zwischen intrinsischer Lernmotivation und schulischen Leistungen einen positiven Zusammenhang gibt. Leistungs- als auch wettbewerbsbezogene Lernmotivation können signifikant Studienleistungen vorhersagen.

Entwicklung und Förderung motivationaler Merkmale
Bei Schüler*innen zeigt sich eine kontinuierliche Abnahme der Einschätzung der eigenen Fähigkeit und Erfolgserwartung als auch für Fachbezogene Wertüberzeugungen im Laufe der Schulzeit. Dafür gibt es zwei zentrale Gründe. Als erstes werden die evaluierten Rückmeldungen mit zunehmenden Alter der Schüler*innen angemessener interpretiert und die Kinder nehmen dadurch öfter soziale Vergleiche vor. Dadurch wird die Selbsteinschätzung realistischer und deshalb auch vergleichsweise negativer. Der zweite Grund ist das die schulische Lernumgebung sich verändert. Mit steigender Klassenstufe werden Leistungsbewertungen immer stärker und regt dadurch den Wettbewerb zwischen den Schüler*innen an.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gibt es beispielsweise das „Origin-Training“ welches selbstbestimmtes Verhalten betont. Die drei Ansatzpunkte des Trainings sind (1) das Setzten von realistischen Zielen, am besten mittelschwer ausgeprägt, (2) die Durchführung günstiger Ursachenerklärung für Erfolg und Misserfolg und (3) der Aufbau einer positiven Selbstbewertungsbilanz. Unabhängig davon kann eine individuelle Bezugsnorm des Lehrers ähnliche Wirkungen haben.
Studie von: Harackiewicz, J.M., et al. (2012). Helping parents to motivate adolescents in mathematics and science: An experimental test of a utility-value intervention.
Die Studie befasste sich damit, ob eine auf Theorie beruhende Intervention für die Eltern die Bedeutung der MINT-Fächer bei ihren Kindern zu erhöhen. Die Erwartungs-Werttheorie von Eccels soll in diesem Fall die Werte und die akademische Motivation der Kinder prägen, mediiert durch die Überzeugungen der Eltern. Wenn die Eltern ihr Kind nicht überzeugen können das Mathe unterhaltsam (intrinsischer Wert) ist, und auch nicht, dass das Kind gut in Mathe ist (Erwartungshaltung), können sie am besten auf ihr Kind einwirken, wenn sie die Nützlichkeit (Utility Value) des Faches darlegen.
Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass es eine signifikante Wirkung der Intervention gab. Die Schüler der experimentellen Gruppen wählten der letzten zwei Jahre auf der High-School deutlich mehr Mathematik- und Wissenschaftsklassen (8,31 Semester), als die Kontrollgruppe (7,50 Semester).
Auch gab es einen signifikanten Effekt in Bezug auf die Erziehung der Eltern. Die Kinder von Eltern mit einer hoch ausgeprägten Ausbildung belegten ebenfalls mehr MINT Fächer als Kinder von Eltern mit einem geringeren Abschluss.
So stark beeinflussen Lehrer die Motivation und Leistung ihrer Schüler
Häufig hängt die Leistung von Schülern von der Einstellung der Lehrer ab. In einer Studie wurde analysiert, wie die Lehrer ihre Schüler benoten und einschätzen. Gleichzeitig wurde aber auch erhoben wie die Schüler*innen sich selbst einschätzen. Bei den Lehrern ließ sich der sogenannte Pygmalion-Effekt beobachten. Dieses ist ein psychologisches Phänomen, welches auf ein Experiment von Robert Rosenthal und Lenore F. Jacobson zurückgeht. Der Effekt besagt, dass eine vorweggenommene Einschätzung eines Schülers sich derart auf seine Leistung auswirkt, dass sie sich selbst bestätigt. Einfach gesagt ist dies eine sich selbsterfüllende Prophezeiung, nach dem Motto „wem nichts zugetraut wird, der schafft auch oft nichts“.
Vorurteile gegenüber Schüler*innen sind breit gefächert, Beispiele dafür sind unter anderem der Migrationshintergrund, der Bildungshintergrund ihrer Eltern, oder sogar auch ihres Namens. Diese drei Faktoren wirken sich besonders negativ auf die Bewertungen der Schüler*innen aus. Dies ist bereits schon länger ein Thema in der Psychologie und hat bereits viele Studien vorhergebracht.
Eine Wissenschaftlerin der Martin-Luther-Universität Halle Wittenburg (MLU) untersuchte ob negative oder positive Einstellungen von Lehrern und Lehrerinnen zum Gelingen oder auch Misslingen schulischer Erfolge ganzer Klassen beitragen. In der Studie wurden 22 Schulen und 43 Lehrerinnen ausgewählt, die das Fach Mathe oder Deutsch unterrichteten. Wichtig war es, dass die Lehrerinnen ihre Schüler*innen noch nicht lange kannten. Insgesamt ergab sich eine Stichprobe von 635 Schüler*innen. Die Methode der Studie sah so aus, dass zufällig Schüler und Schülerinnen ausgewählt wurden, die von den Lehrerinnen spontan in kurzer, schriftlicher Form von ihren Lehrerinnen beschrieben wurden. Anschließend wurden die positiven und negativen Beschreibungen ausgewertet. Den teilnehmenden Schüler*innen wurden anschließend Fragen gestellt. Gefragt wurde nach möglichen Versagensängsten, ihren Noten, ihrer Motivation und dem Verhältnis zu ihren Lehrerinnen. Anschließend wurde diese Befragung nach vier Monaten wiederholt.

Ergebnisse der Studie:
Die Wissenschaftlerin kam zu dem überraschendem Ergebnis, das nur die Zahl der negativen Einstellungen der Lehrerinnen einen Einfluss auf die Motivation hatten. Versagensängste bei den Schüler*innen waren besonders hoch ausgeprägt, wenn die Schüler und Schülerinnen, die negativen Einstellungen der Lehrerinnen gegenüber ihnen bemerkten. Positive Einschätzungen jedoch sorgten für eine größere Leistungsfähigkeit bei den Schüler*innen, sie hatten ihre Noten deutlich verbessert.
Durch das Längsschnittdesign der Studie konnte auch ausgeschlossen werden, dass die Lehrerinnen die positiv eingestellt waren, von Anfang an bessere Noten gaben. Teilweise waren ganze Schulen von großen Versagensängsten betroffen, wenn Schüler und Schülerinnen besonders häufig von negativen Bewertungen betroffen waren. Daraus lässt sich schließen, dass die Einstellungen von Lehrkräften sich nicht nur auf einzelne Schüler und Schülerinnen auswirken, sondern auch einen Einfluss auf die ganze Schule haben können.
Die Studienergebnisse legen dar das Schüler und Schülerinnen in einer positiven Schulatmosphäre das Potenzial haben sich stark zu entfalten. Vorteilhaft wäre es natürlich bereits zukünftigen Lehrkräften dafür bereits im Studium zu sensibilisieren. Oder für dieses Thema gewisse Schulungen durchzuführen. Auch kann es Präventionen gegen Erschöpfung bei Lehrer*innen helfen. Denn erschöpfte Lehrer*innen haben auch oft negative Haltungen gegenüber Schülern und Schülerinnen.
Interventionen gegen mangelnde Motivation durch DNLA
Mithilfe von DNLA kann man die momentane Ausprägung der Motivation messen. Um sich ein genaueres Bild von dem Faktor „Motivation“ zu machen, wird dieser einmal kurz vorgestellt.
Wenn hohes Potenzial bei einem Teilnehmer*in vorhanden ist, engagiert dieser sich bei den gestellten Aufgaben und identifiziert sich mit den Zielen des Unternehmens. Sie wollen immer das Bestmöglichste für sich, ihre Mitarbeiter*innen und Kollegen*innen und auch für das Unternehmen herausholen. Wichtig ist das sie sich deutlich am Leistungsprinzip orientieren. Dadurch profitieren sie auch von mehr Fleiß, Ausdauer und Teamverhalten. Da ihr Engagement gut sichtbar für jeden ist, motiviert es im Besten Fall andere Mitarbeiter*innen mitzuziehen. Falls ihre Leistung hinter denen von manchen Kollegen*innen ist, strengen diese sich besonders an, um die Leistungslücke zu schließen.
Im umgekehrten Fall, wenn das Potenzial eines/er Mitarbeiter*in niedrig ausgeprägt ist, sind sie weniger motiviert und dadurch weniger ehrgeizig. Sie arbeiten ungern nach dem Leistungsprinzip und betrachten dieses eher mit Skepsis. Die geringe Motivation kann durch viele Faktoren begründet sein. Die Häufigsten sind Probleme im privaten Bereich oder Spannungen mit Vorgesetzten. Aber auch Streitigkeiten mit Kollegen*innen können ein Absinken der Motivation bedingen. Diese negativen Einflüsse wirken sich negativ auf die Leistungsmotivation aus. Vorschläge von anderen finden bei gering motivierten Personen keinen Anschluss. Evaluationen zur Verbesserung der Organisation oder der Zusammenarbeit im Team werden pessimistisch betrachtet oder gar abgelehnt.
Die Wichtigkeit von Motivation
Jetzt da die positiven und negativen Aspekte des Faktors „Motivation“ bei der DNLA vorgestellt wurden, zeigt sich noch einmal, wie wichtig dieser ist. Ist dieser Faktor gering ausgeprägt, führt er zu einer Kette von negativen Auswirkungen auf andere Bereiche, wie bereits vorher in diesem Artikel durch verschiedene Studien dargestellt. DNLA verfügt über verschiedene Tools die maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten sind. Der wohl am häufigsten eingesetzte ist das Tool der „Erfolgsprofil sozialer Kompetenz“ kurz ESK genannt. Es gibt aber auch weitere, wie das Tool „Management“ (MM), das „Stress Survey“ (MSS), oder auch für die Teamanalyse (TA). Zu diesen gibt es auch noch 10 andere maßgeschneiderte Tools, die Sie gerne auf unserer Website erkunden können (https://www.dnla.de/).
Auch interessant und eine weitere Vertiefung ist ein weiterer Artikel auf unserer Seite zum Thema Motivation bei der Arbeit, der sich mit dem Aufbau und Erhalt beschäftigt.
Quellen:
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dia/mindmag82-tgb.pdf
Harackiewicz, J.M., Rozek, C.R., Hulleman, C.S., & Hyde, J.S. (2012) Helping parents to motivate adolescents in mathematics and science: An experimental test of a utility-value intervention. Psychological Science, 40, 899-906.
„Motivation“ – aus Pädagogischer Psychologie (S. 153-175). Wild, E. (2015)
Deci, Edward L.; Ryan, Richard M.: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik – In: Zeitschrift für Pädagogik 39 (1993) 2, S. 223-238 – URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-111739
Motivation bei der Arbeit aufbauen und erhalten – Dafür arbeite ich
Reihe „Erfolg im Beruf“: Folge 4: Intrinsische Motivation.

Motivation: Was ist das eigentlich?
„Motivation“ – ein Schlagwort, das man kaum noch hören kann? Zum Thema Motivation bei der Arbeit gibt es unzählige Texte und Ratgeber. Aber worum geht es bei Motivation wirklich? Ist sie wirklich so wichtig bei der Arbeit? Und wenn ja, wie entsteht sie und wie kann man die Motivation aufbauen und erhalten? Zumindest sollte sie sich nicht, wie es so oft geschieht, noch weiter abbauen.
Was treibt uns wirklich an und was ist uns wirklich wichtig? – In unserer Reihe „Erfolg im Beruf“ stellen wir Erfolgsfaktoren für den beruflichen Bereich vor. Heute: Der Faktor „Motivation“[1].
Kann ich das? – Selbstvertrauen bei der Arbeit
Reihe „Erfolg im Beruf“: Folge 3: Selbstvertrauen.

„Kann ich das?“ – Selbstvertrauen bei der Arbeit und durch was es maßgeblich beeinflusst wird. – In unserer Reihe „Erfolg im Beruf“ stellen wir Erfolgsfaktoren für den beruflichen Bereich vor. Heute: Der Faktor „Selbstvertrauen“[1]. Wir zeigen, wie es entsteht und wodurch es beeinflusst wird. Lesen Sie im Folgenden über die häufigsten Gründe, die das Selbstvertrauen am Arbeitsplatz schrumpfen lassen – und was man tun kann, um das Selbstvertrauen gezielt wieder aufzubauen.
(mehr …)Fehlender Sinn bei der Arbeit raubt die Motivation und macht krank
Zuerst fehlt die Motivation – dann die Mitarbeiter.
Wer die eigene Arbeit als sinnvoll empfindet ist seltener krank.
Fehlender Sinn bei der Arbeit raubt die Motivation und macht krank: Eine Untersuchung des wissenschaftlichen Instituts der AOK unter 2000 Beschäftigten kommt zu interessanten Ergebnissen. Gefragt wurde nach Fehlzeiten, Arbeitsausfall – und der Stimmung am Arbeitsplatz. Ein Zusammenhang fällt dabei ins Auge: Physische Schmerzen, zum Beispiel Rückenprobleme, Erschöpfung und psychische Probleme führen gehäuft dann auch tatsächlich zu Arbeitsausfällen, wenn die Betroffenen mit ihrer Arbeit und mit ihrem Arbeitsumfeld unzufrieden sind. Außerdem nehmen psychische Beschwerden immer mehr zu. Diejenigen, die einem schlechten Betriebsklima ausgesetzt waren, fehlten mehr als eineinhalb Mal so lange wie die Kolleginnen und Kollegen mit einem guten und motivierenden Arbeitsumfeld.

Zu viel Druck im Job – Wie man mit Erwartungshaltungen richtig umgeht.
Reihe „Erfolg im Beruf“: Folge 2: Leistungsmotivation und Leistungserwartung.

„Wie soll ich das bloß schaffen“? – Zu viel Druck im Job – In unserer Reihe „Erfolg im Beruf“ stellen wir Erfolgsfaktoren für den beruflichen Bereich vor. Heute: Der Faktor „Leistungsmotivation und Leistungserwartung“[1], (auch „Leistungsdrang“ genannt).
(mehr …)Video: DNLA beim Kongress für Unternehmensbegeisterung
Rückschau und Ausblick, wie es weiter geht
Am 29. und 30.01. fand – online – der Kongress für Unternehmensbegeisterung statt und DNLA war dabei (siehe auch https://www.dnla.de/dnla-beim-kongress-fuer-unternehmensbegeisterung/). Hier berichten wir, was sich seit dem Kongress getan hat. Außerdem zeigen wir auch ein spannendes Video vom DNLA-Vortrag beim Kongress.

Erfolg im Beruf: „Da kann man sowieso nichts machen“? – Wie man schwierige Situationen im Job positiv beeinflussen kann.
Reihe „Erfolg im Beruf“: Folge 1: Selbstwirksamkeit
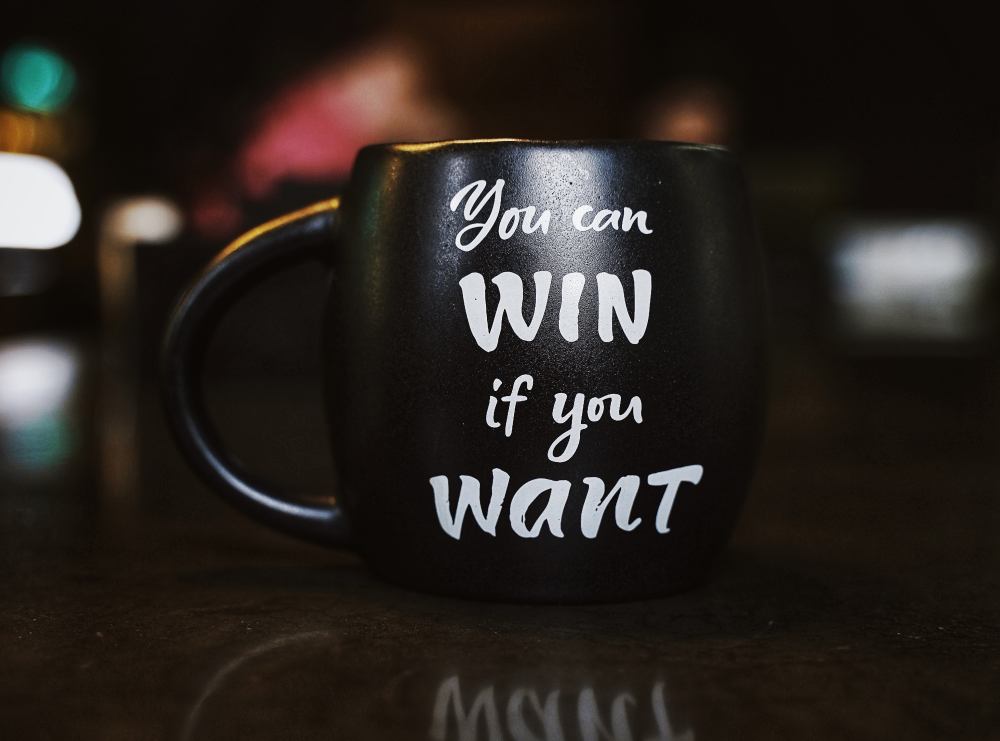
In unserer Reihe „Erfolg im Beruf“ stellen wir Erfolgsfaktoren für den beruflichen Bereich vor. Heute: Der Faktor „Selbstwirksamkeit“[1], auch „Eigenverantwortlichkeit“ genannt.
(mehr …)Die neuen DNLA-Factsheets: Ergänzt um 2 neue Themen; plus all Factsheets now available in English!
Even more information, for domestic and international clients.
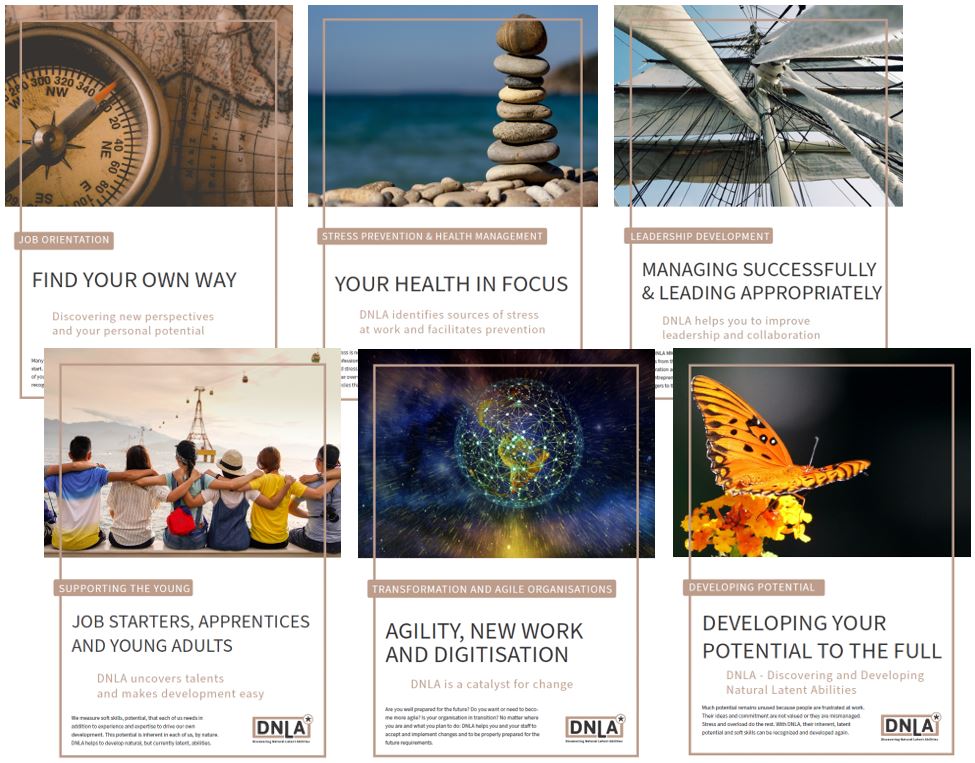
DNLA beim Kongress für Unternehmensbegeisterung
Vortrag am 29. und 30.01. – Begeisterte Mitarbeiter für begeisternde Unternehmen

Besser führen: Mit Haltung und Vertrauen zu Loyalität
Mit diesem Titel kommt ab Januar ein neues Fachbuch, auch zu DNLA, in den Handel.
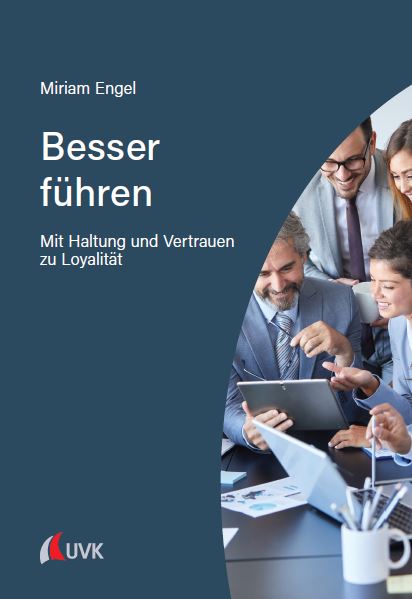
Fachbuch und Praxisratgeber für Führungskräfte, Chefs und Unternehmer: „Besser führen“ zeigt, wie man loyale, zufriedene, motivierte und erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt und behält.
Loyale Mitarbeiter sind motivierter, arbeiten produktiver und bringen dem Unternehmen enorme Wettbewerbsvorteile. Doch wie schafft man diese treue Bindung?
(mehr …)Warum Unternehmen ihre besten Mitarbeiter verlieren
8 Dinge, die erfolgreiche Mitarbeiter frustrieren – und was man dagegen tun kann

Es ist leider ein altbekanntes Phänomen, und leider hat sich hier bisher auch wenig zum Guten verändert: Immer wieder verlieren Unternehmen ihre besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil diese unzufrieden sind und kündigen.
(mehr …)Warum fehlt es so häufig an Wertschätzung am Arbeitsplatz?
Anerkennung schafft zufriedene Mitarbeiter.

58 % der Beschäftigten in Europas Unternehmen fühlen sich in ihrer Leistung nicht ausreichend wertgeschätzt. In der Studie der Beratungsgesellschaft Hewitt Associates wurden insgesamt 120.000 Mitarbeiter, 3.000 Führungskräfte aus knapp 600 Unternehmen befragt. Woran kann es liegen, dass es so häufig an der Werschätzung am Arbeitsplatz mangelt?
(mehr …)
Guten Tag!
Ihr direkter Draht zu DNLA - Wir beantworten alle Ihre Anfragen schnell und konkret.

